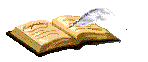
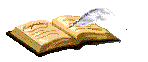 Dunkelwasser (2)
Dunkelwasser (2)
| Historica Gideon 11. Dekade der Zeit |

Schauplatz :
 Farhain
Farhain
 18.Eintrag
18.Eintrag
 Der trockene Pfad schlängelte sich in vielen großen Windungen durch die Ebene. Unzählige Räder, Hufe und Füße hatten diesen Weg erzeugt und das Gras verbannt. Hin und wieder lugte ein freches Büschel grün durch die verkrustete Schicht, ein paar graue Steine lagen herum und viele Schlaglöcher straften den unvorsichtigen Wanderer. Die flache Landschaft beherbergte weit ausgedehnte Felder und Wiesen, sowie die dicht stehenden Bäume des großen Farhain Waldes. Hin und wieder tauchte ein Gehöft auf, bestellte Ackerfläche und grasendes Vieh: Finböcke, Talrinder, die dicken Wollundschafe und eine Rotte Schweine. Die Gegend war friedlich, fruchtbar und ein abgelegenes Örtchen jenseits des Trubels der Handelsstraße. Der Morgennebel hatte sich längst verzogen und die Sonne schien angenehm warm. Auf einer großflächigen, sanften Erhebung tauchten einige Häuser auf: Das Dorf Farhain. Zwischen den Gebäuden gab es immer wieder Bäume, Wiesen und Buschwerk. Von weitem konnte man keine klare Anordnung erkennen. Nijura zweifelte, ob es überhaupt eine gab. Bei den meisten kleinen Dörfern sammelten sich die Gebäude entlang einer Straße oder Flusses, manche, in den gefährlicheren Gegenden, waren kreisförmig gebaut. Die Gebäude dort vorne schienen irgendwie nach Lust und Laune zwischen den einzelnen Bäumen zu stehen. Nijura, Charie, Seylina, Boradin und Brandur betraten das Dorf.
Der trockene Pfad schlängelte sich in vielen großen Windungen durch die Ebene. Unzählige Räder, Hufe und Füße hatten diesen Weg erzeugt und das Gras verbannt. Hin und wieder lugte ein freches Büschel grün durch die verkrustete Schicht, ein paar graue Steine lagen herum und viele Schlaglöcher straften den unvorsichtigen Wanderer. Die flache Landschaft beherbergte weit ausgedehnte Felder und Wiesen, sowie die dicht stehenden Bäume des großen Farhain Waldes. Hin und wieder tauchte ein Gehöft auf, bestellte Ackerfläche und grasendes Vieh: Finböcke, Talrinder, die dicken Wollundschafe und eine Rotte Schweine. Die Gegend war friedlich, fruchtbar und ein abgelegenes Örtchen jenseits des Trubels der Handelsstraße. Der Morgennebel hatte sich längst verzogen und die Sonne schien angenehm warm. Auf einer großflächigen, sanften Erhebung tauchten einige Häuser auf: Das Dorf Farhain. Zwischen den Gebäuden gab es immer wieder Bäume, Wiesen und Buschwerk. Von weitem konnte man keine klare Anordnung erkennen. Nijura zweifelte, ob es überhaupt eine gab. Bei den meisten kleinen Dörfern sammelten sich die Gebäude entlang einer Straße oder Flusses, manche, in den gefährlicheren Gegenden, waren kreisförmig gebaut. Die Gebäude dort vorne schienen irgendwie nach Lust und Laune zwischen den einzelnen Bäumen zu stehen. Nijura, Charie, Seylina, Boradin und Brandur betraten das Dorf.
 Der Weg wurde breiter und das erste Gebäude auf der linken Seite war eine sauber gezimmerte Hütte mit einem hübschen, sehr gepflegten Blumen- und Kräutergarten. Eine kleine, kniehohe Umzäunung sollte unaufmerksame Besucher vom betreten der Beete, die Rund um die Hütte angelegte waren, abhalten. Die Hütte selbst war mit grünem Laub auf Dach und Wand geschmückt. Nijura erkannte einige Kräuter, die dort zum trocknen aufgehängt waren. Linker Hand kamen sie an einem festen rötlich gemauerten Haus vorbei. Eine beschlagene Tür, schmale Fenster und eine Art Zinnenrand am Dach erinnerten mehr an eine kleine Festung, als an ein Wohnhaus. An der Wand stand eine Holzbank, umgeben von Büschen zwischen denen eine größere Hundehütte hervorlugte. Bald öffnete sich der Weg zu einer breiten trockenen Fläche in deren Mitte ein imposanter Brunnen stand. Um den Platz herum standen die unterschiedlichsten Hütten, Häuser, Vorratsspeicher und Konstruktionen. An vielen der Häuser hingen Schilder mit Namen oder Handelssymbolen, manche hatten schräge Ausstellflächen für Waren und bei zwei Gebäuden gab es sogar richtige überdachte Marktstände. Dominiert wurde dieser Platz von einem alle anderen überragenden, zweistöckigen Gasthaus mit kleiner Stallung. Einige Stufen führten zu einer Veranda an der Eingangstür des Gebäudes. Über der Tür war ein dampfender Topf aufgemalt und der Schriftzug: Willkommen im Farhainer Hof. Die Fenster schmückten Blumenkästen und die blaugrüne Farbe von Stoffvorhängen schimmerte nach draußen. Auf den offenen Fensterläden waren sorgfältig Krüge, Fässer, Essutensilien und Tiere gemalt. Der Besitzer schien sich reichlich Mühe zu geben, sein Gasthaus zu gestalten.
Der Weg wurde breiter und das erste Gebäude auf der linken Seite war eine sauber gezimmerte Hütte mit einem hübschen, sehr gepflegten Blumen- und Kräutergarten. Eine kleine, kniehohe Umzäunung sollte unaufmerksame Besucher vom betreten der Beete, die Rund um die Hütte angelegte waren, abhalten. Die Hütte selbst war mit grünem Laub auf Dach und Wand geschmückt. Nijura erkannte einige Kräuter, die dort zum trocknen aufgehängt waren. Linker Hand kamen sie an einem festen rötlich gemauerten Haus vorbei. Eine beschlagene Tür, schmale Fenster und eine Art Zinnenrand am Dach erinnerten mehr an eine kleine Festung, als an ein Wohnhaus. An der Wand stand eine Holzbank, umgeben von Büschen zwischen denen eine größere Hundehütte hervorlugte. Bald öffnete sich der Weg zu einer breiten trockenen Fläche in deren Mitte ein imposanter Brunnen stand. Um den Platz herum standen die unterschiedlichsten Hütten, Häuser, Vorratsspeicher und Konstruktionen. An vielen der Häuser hingen Schilder mit Namen oder Handelssymbolen, manche hatten schräge Ausstellflächen für Waren und bei zwei Gebäuden gab es sogar richtige überdachte Marktstände. Dominiert wurde dieser Platz von einem alle anderen überragenden, zweistöckigen Gasthaus mit kleiner Stallung. Einige Stufen führten zu einer Veranda an der Eingangstür des Gebäudes. Über der Tür war ein dampfender Topf aufgemalt und der Schriftzug: Willkommen im Farhainer Hof. Die Fenster schmückten Blumenkästen und die blaugrüne Farbe von Stoffvorhängen schimmerte nach draußen. Auf den offenen Fensterläden waren sorgfältig Krüge, Fässer, Essutensilien und Tiere gemalt. Der Besitzer schien sich reichlich Mühe zu geben, sein Gasthaus zu gestalten.
 Die Gruppe hielt am Brunnen und schaute sich weiter um. Während Brandur die Taverne musterte und seine Nase versuchte, einen guten Essensduft aufzufangen, zeigte Seylina auf ein hübsches Fachwerkhausweiter im Norden, das von einer kleinen Mauer mit metallenem Tor geschützt war. An dem Tor prangten die heraldischen Zeichen des Landes: Ein grüner Baum über einem roten Stier und einem Wagenrad. Keines, was einem Kundigen wirklich geläufig wäre. Boradin hörte rhythmische Hammerschläge hinter dem Gasthaus. Für seine Ohren klang es nach Schmiedearbeit und der dunkle Rauch, der in den Himmel stieg, bestätigte seine Meinung, dass es eine anständige Schmiede in Farhain geben müsste. Südlich des Gasthauses betrachtete Nijura eine gedrungene rundliche Hütte aus Bruchstein und Astwerk. Die Tür hing leicht schief, die Fensteröffnung wurde von einem dunkelgrünen Vorhang geschlossen. Neben dem Gebäude waren sehr unterschiedliche Hölzer gestapelt: Dicke, dünne, krumme, grade, helle, dunkle, lange und kurze. Sicher kein Feuerholz. An einige hatte deutlich der Zahn der Zeit genagt. Was überhaupt nicht zu der bescheidenen Hütte passte, war der schwarze muskulöse Hengst, der seitlich des Hauses ein paar Grasnarben abknabberte. Nach der Erfahrung der Waldläuferin, würde das Tier einen stolzen Preis bringen, wenn der Besitzer es überhaupt je verkaufen würde.
Die Gruppe hielt am Brunnen und schaute sich weiter um. Während Brandur die Taverne musterte und seine Nase versuchte, einen guten Essensduft aufzufangen, zeigte Seylina auf ein hübsches Fachwerkhausweiter im Norden, das von einer kleinen Mauer mit metallenem Tor geschützt war. An dem Tor prangten die heraldischen Zeichen des Landes: Ein grüner Baum über einem roten Stier und einem Wagenrad. Keines, was einem Kundigen wirklich geläufig wäre. Boradin hörte rhythmische Hammerschläge hinter dem Gasthaus. Für seine Ohren klang es nach Schmiedearbeit und der dunkle Rauch, der in den Himmel stieg, bestätigte seine Meinung, dass es eine anständige Schmiede in Farhain geben müsste. Südlich des Gasthauses betrachtete Nijura eine gedrungene rundliche Hütte aus Bruchstein und Astwerk. Die Tür hing leicht schief, die Fensteröffnung wurde von einem dunkelgrünen Vorhang geschlossen. Neben dem Gebäude waren sehr unterschiedliche Hölzer gestapelt: Dicke, dünne, krumme, grade, helle, dunkle, lange und kurze. Sicher kein Feuerholz. An einige hatte deutlich der Zahn der Zeit genagt. Was überhaupt nicht zu der bescheidenen Hütte passte, war der schwarze muskulöse Hengst, der seitlich des Hauses ein paar Grasnarben abknabberte. Nach der Erfahrung der Waldläuferin, würde das Tier einen stolzen Preis bringen, wenn der Besitzer es überhaupt je verkaufen würde.
 Nijura fielen die dunklen Flecken und Schleifspuren auf der Straße auf. Sie waren frisch. Zusammen mit Charie folgte sie der Straße bis zu einem Fleck, an dem mehrere Spuren zusammenführten. Nijura hob ein Stück Leinenstoff auf. Er war zerfetzt und voller verkrustetem Blut. Unbewusst lockerte sie ihren Langdolch. Charie hob die Hand und machte eine weit ausladende Geste über das Dorf hinweg. Nijura verstand zuerst nicht, was die Auelfin meinte. Erneut schwenkte sie ihren Blick über die Gebäude. Menschen? Es war niemand da! Man sollte meinen, wenn fünf Fremde ein Dorf betreten, würden einige Neugierige sich blicken lassen. Zumindest ein paar Kindern kamen immer gerannt, wenn Zwerge oder Elfen unter ihren Begleitern waren.
Nijura fielen die dunklen Flecken und Schleifspuren auf der Straße auf. Sie waren frisch. Zusammen mit Charie folgte sie der Straße bis zu einem Fleck, an dem mehrere Spuren zusammenführten. Nijura hob ein Stück Leinenstoff auf. Er war zerfetzt und voller verkrustetem Blut. Unbewusst lockerte sie ihren Langdolch. Charie hob die Hand und machte eine weit ausladende Geste über das Dorf hinweg. Nijura verstand zuerst nicht, was die Auelfin meinte. Erneut schwenkte sie ihren Blick über die Gebäude. Menschen? Es war niemand da! Man sollte meinen, wenn fünf Fremde ein Dorf betreten, würden einige Neugierige sich blicken lassen. Zumindest ein paar Kindern kamen immer gerannt, wenn Zwerge oder Elfen unter ihren Begleitern waren.
 19.Eintrag
19.Eintrag
 In der Hütte war es dunkel. Die geschlossenen Vorhänge ließen nur spärlich Licht ins Innere der Stube fallen. Die Einrichtung war einfach, gepflegt und ordentlich: Ein schwerer Eichenschrank, mehrere Regale voller Töpfe, Tiegel und Schalen, ein massiver Tisch aus Farhainholz, ein Kamin mit Kochstelle, sowie zwei Schlafstätten. Die eine war säuberlich gerichtet und unbenutzt. Auf der anderen, zerwühlten, saß ein Mädchen von vielleicht 16 Götterläufen in einem rauen, dunkelblauen Wollkleid mit langen Ärmeln. Ihr Blick drang wehmütig in die Ferne, als warte sie sehnlichst auf etwas. Auf jemanden. Das junge Mädchen gab sich einen Ruck und atmete tief durch. Er würde nicht mehr wieder kommen. Warum war sie auch nur so stur gewesen? Gedankenverloren zog sie ein schwarzes Kopftuch tiefer in die Stirn. Sie hatte ihre Haare zu breiten Zöpfe geflochten und diese um den schmalen Kopf geschwunden: Haare mit der Farbe des Lichts einer aufgehenden Sonne. Ihre Gedanken kreisten weiter: Sein Dahinsiechen, dieser schleichende Tod hatte sie wütend gemacht. Sie hatte nichts tun können. Es hatte ihr fast den Verstand geraubt. Und er hatte sich so Gott verdammt demütig in sein Schicksal begeben. Die Nähe seines Todes hatte sie nicht ausgehalten, sie nicht. Aber er! Unbewusst fuhr sie sich mit dünnen, blassen Fingern über den Hals und erreichte ein enges, schwarzes Halsband. Es erschien ein wenig zu breit zu sein für den zierlichen Hals, aber nicht breit genug, um mit seinem Flechtwerk die großen Narben ganz zu verbergen. Ihre düsteren Gedanken umklammerten sie: Untätig seinen Tod begleiten, war nicht auszuhalten gewesen. Sie hatte ihn überzeugen wollen, dass sie es finden würde, sie ihm helfen könnte. Sie allein! Sie war überzeugt gewesen. Irgendwo am Waldesrand oder im Farhain, wie er immer alles gefunden hatte auf ihren langen gemeinsamen Wanderungen. Vor dem Morgengrauen war sie aufgebrochen, ohne noch einmal nach ihm zu schauen. Jetzt wusste sie, sie hatte damit nur ihre eigene Selbstgefälligkeit befriedigen wollen. Zugefügt hatte sie sich einzig bleibende und nagende Risse in Gedanken und im Herzen. Sie würde sich immer wieder fragen, ob sie ihn nicht hätte allein lassen dürfen. Ausgerechnet sie, seine Tochter. Nichts hatte sie gefunden, kein hilfreiches Kraut, kein passendes Sekret, keinen stärkenden Pilz, kein heilendes Moos. Und viel schlimmer, vor lauter unbändig verletztem Stolz hatte sie den Rückweg erst spät am Abend begonnen. Als sie ins Haus getreten war, hatte er sie angelächelt. So wie er es seit Tagen nicht mehr in seinem geschwächten, dämmrigen Zustand getan hatte. Nach all dem Leid, dass er hatte sehen müssen. Er ist mir nicht böse, hatte sie gedacht und war zu ihm geeilt. Das Lächeln war auf seinen Lippen geblieben … für immer. Kein Atem hatte seinen Körper mehr belebt. Er war tot. Und sie? Sie war wieder allein.
In der Hütte war es dunkel. Die geschlossenen Vorhänge ließen nur spärlich Licht ins Innere der Stube fallen. Die Einrichtung war einfach, gepflegt und ordentlich: Ein schwerer Eichenschrank, mehrere Regale voller Töpfe, Tiegel und Schalen, ein massiver Tisch aus Farhainholz, ein Kamin mit Kochstelle, sowie zwei Schlafstätten. Die eine war säuberlich gerichtet und unbenutzt. Auf der anderen, zerwühlten, saß ein Mädchen von vielleicht 16 Götterläufen in einem rauen, dunkelblauen Wollkleid mit langen Ärmeln. Ihr Blick drang wehmütig in die Ferne, als warte sie sehnlichst auf etwas. Auf jemanden. Das junge Mädchen gab sich einen Ruck und atmete tief durch. Er würde nicht mehr wieder kommen. Warum war sie auch nur so stur gewesen? Gedankenverloren zog sie ein schwarzes Kopftuch tiefer in die Stirn. Sie hatte ihre Haare zu breiten Zöpfe geflochten und diese um den schmalen Kopf geschwunden: Haare mit der Farbe des Lichts einer aufgehenden Sonne. Ihre Gedanken kreisten weiter: Sein Dahinsiechen, dieser schleichende Tod hatte sie wütend gemacht. Sie hatte nichts tun können. Es hatte ihr fast den Verstand geraubt. Und er hatte sich so Gott verdammt demütig in sein Schicksal begeben. Die Nähe seines Todes hatte sie nicht ausgehalten, sie nicht. Aber er! Unbewusst fuhr sie sich mit dünnen, blassen Fingern über den Hals und erreichte ein enges, schwarzes Halsband. Es erschien ein wenig zu breit zu sein für den zierlichen Hals, aber nicht breit genug, um mit seinem Flechtwerk die großen Narben ganz zu verbergen. Ihre düsteren Gedanken umklammerten sie: Untätig seinen Tod begleiten, war nicht auszuhalten gewesen. Sie hatte ihn überzeugen wollen, dass sie es finden würde, sie ihm helfen könnte. Sie allein! Sie war überzeugt gewesen. Irgendwo am Waldesrand oder im Farhain, wie er immer alles gefunden hatte auf ihren langen gemeinsamen Wanderungen. Vor dem Morgengrauen war sie aufgebrochen, ohne noch einmal nach ihm zu schauen. Jetzt wusste sie, sie hatte damit nur ihre eigene Selbstgefälligkeit befriedigen wollen. Zugefügt hatte sie sich einzig bleibende und nagende Risse in Gedanken und im Herzen. Sie würde sich immer wieder fragen, ob sie ihn nicht hätte allein lassen dürfen. Ausgerechnet sie, seine Tochter. Nichts hatte sie gefunden, kein hilfreiches Kraut, kein passendes Sekret, keinen stärkenden Pilz, kein heilendes Moos. Und viel schlimmer, vor lauter unbändig verletztem Stolz hatte sie den Rückweg erst spät am Abend begonnen. Als sie ins Haus getreten war, hatte er sie angelächelt. So wie er es seit Tagen nicht mehr in seinem geschwächten, dämmrigen Zustand getan hatte. Nach all dem Leid, dass er hatte sehen müssen. Er ist mir nicht böse, hatte sie gedacht und war zu ihm geeilt. Das Lächeln war auf seinen Lippen geblieben … für immer. Kein Atem hatte seinen Körper mehr belebt. Er war tot. Und sie? Sie war wieder allein.
 Draußen waren Schritte zu hören. Ihre bernsteinfarbenen Augen blitzten auf als sie den Kopf hob, um die Richtung des Geräusches zu bestimmen. Sie schob den Vorhang mit einem Finger einen Spalt zur Seite und schielte hinaus. Eine merkwürdig anmutende Gruppe von Gestalten lief in das Dorf. Die kleinen Männer hatten wallende Bärte, schwere Rüstungen und stampften den Weg hinauf. Die beiden grazilen Frauen mit schimmernd glänzenden Haaren und eleganter Lederkleindung schwebten den Männern hinterher. Am Ende der Gruppe lief eine Frau, in der das Mädchen eine der Waldläuferinnen erkannte, von der Edda so oft erzählt hatte und Buck, der einfältige Stallbursche.
Draußen waren Schritte zu hören. Ihre bernsteinfarbenen Augen blitzten auf als sie den Kopf hob, um die Richtung des Geräusches zu bestimmen. Sie schob den Vorhang mit einem Finger einen Spalt zur Seite und schielte hinaus. Eine merkwürdig anmutende Gruppe von Gestalten lief in das Dorf. Die kleinen Männer hatten wallende Bärte, schwere Rüstungen und stampften den Weg hinauf. Die beiden grazilen Frauen mit schimmernd glänzenden Haaren und eleganter Lederkleindung schwebten den Männern hinterher. Am Ende der Gruppe lief eine Frau, in der das Mädchen eine der Waldläuferinnen erkannte, von der Edda so oft erzählt hatte und Buck, der einfältige Stallbursche.
 Gernin Nurbart seufzte leise vor sich hin. Die Versammlung der Dorfbewohner lief seit mehr als zwei Stunden und stand unter keinem guten Stern. Schandan Erzhammer und seine Frau waren erst gar nicht gekommen. Edda Vogelsang lag schwer krank in ihrer Hütte, von den Lunigans fehlte jede Spur, die Händler Vilfinger und Pfaffi stritten sich wie üblich, die Gastleute Kraut hatten vor einer Woche die Taverne geschlossen und vertraten fest den Standpunkt, dass alle besser daran taten, so schnell wie möglich diese Gegend zu verlassen, bevor der Fluch das gesamte Dorf dahinraffen würde. Viele der Bauern waren schlau gewesen und hatten bereits das Weite gesucht. Nurbart konnte es ihnen schwer verübeln. Trotzdem durfte man den Bogen nicht einfach ins Korn werfen. Er war als Dorfvorsteher für die Gemeinschaft verantwortlich. Man musste herausfinden, was los war. Warum das Wasser auf einmal die Tiere und Menschen krank machte. Er und die anderen hatten so viele Jahre des Glücks hier erfahren, manche über Generationen hinweg. Das durfte man nicht wegwerfen, wie ein verfaultes Ei. Nurbart entfuhr erneut ein Seufzer. Der alte Franzibian hätte selbst mit so einem Ei etwas nützliches Anfangen können. Seine arme Ziehtochter, Aera Pan, war ebenfalls nicht unter den Anwesenden. Sie machte sich zerstörerische Selbstvorwürfe wegen des Todes ihres Mentors. Ausgerechnet die beiden hatten die meiste Erfahrung mit Krankheiten und Giften. Franzibian hatte die Nächte durch gearbeitet, ohne Erfolg, bis ihn die Krankheit und am Ende der Tod selbst ereilte hatte. Was blieb ihnen übrig? Die anderen Anwesenden schwiegen. Alle hatten direkt oder indirekt einen Verlust zu verschmerzen. Außer dieser Reisende dort drüben.
Gernin Nurbart seufzte leise vor sich hin. Die Versammlung der Dorfbewohner lief seit mehr als zwei Stunden und stand unter keinem guten Stern. Schandan Erzhammer und seine Frau waren erst gar nicht gekommen. Edda Vogelsang lag schwer krank in ihrer Hütte, von den Lunigans fehlte jede Spur, die Händler Vilfinger und Pfaffi stritten sich wie üblich, die Gastleute Kraut hatten vor einer Woche die Taverne geschlossen und vertraten fest den Standpunkt, dass alle besser daran taten, so schnell wie möglich diese Gegend zu verlassen, bevor der Fluch das gesamte Dorf dahinraffen würde. Viele der Bauern waren schlau gewesen und hatten bereits das Weite gesucht. Nurbart konnte es ihnen schwer verübeln. Trotzdem durfte man den Bogen nicht einfach ins Korn werfen. Er war als Dorfvorsteher für die Gemeinschaft verantwortlich. Man musste herausfinden, was los war. Warum das Wasser auf einmal die Tiere und Menschen krank machte. Er und die anderen hatten so viele Jahre des Glücks hier erfahren, manche über Generationen hinweg. Das durfte man nicht wegwerfen, wie ein verfaultes Ei. Nurbart entfuhr erneut ein Seufzer. Der alte Franzibian hätte selbst mit so einem Ei etwas nützliches Anfangen können. Seine arme Ziehtochter, Aera Pan, war ebenfalls nicht unter den Anwesenden. Sie machte sich zerstörerische Selbstvorwürfe wegen des Todes ihres Mentors. Ausgerechnet die beiden hatten die meiste Erfahrung mit Krankheiten und Giften. Franzibian hatte die Nächte durch gearbeitet, ohne Erfolg, bis ihn die Krankheit und am Ende der Tod selbst ereilte hatte. Was blieb ihnen übrig? Die anderen Anwesenden schwiegen. Alle hatten direkt oder indirekt einen Verlust zu verschmerzen. Außer dieser Reisende dort drüben.
 Nurbart hob seinen Blick und musterte den Fremdling. Die große und durchaus hagere Gestalt des jungen Mannes wirkte ein wenig gebrechlich unter dem hellen, weiten Reisegewand. Eine einfach geflochtene Kordel hielt den Stoff um die Taille zusammen und diente gleichzeitig einer schmucklosen, ledernen Dolchscheide als Befestigung. Abgetragene, leichte Lederstiefel lugten unter dem vom Staub der Straße verschmutzten Saum des Gewands hervor. Seine linke Hand, blass und feingliedrig, umschloss locker einen kunstvoll verzierten Stab aus dunklem Holz. Ein von einer filigranen Silberspange gehaltener Umhang mit eingestickten silbernen Symbolen erweckte den Anschein, als würde der weiche, dunkelblaue Stoff von innen heraus schimmern. Im Vergleich zu seinem Gewand war der Umhang makellos und peinlichst gepflegt. Das Gesicht, eingerahmt von leicht gewellten, schulterlangen, nachtschwarzen Haar, einem gepflegten Kinnbart und einem gezwirbelten Schnauzer, war von vornehmer Blässe. Hohe Wangenknochen und eine schlanke Nase verliehen ihm scharf geschnittene, kantige Züge. Der Mann war vor zwei Tagen im Dorf eingetroffen. Einer der vielen, die die Abzweigung der Hauptstraße verpasst hatten und in Farhain eine Unterkunft gesucht hatte. Da das Gasthaus geschlossen war, hatte Nurbart den Mann kurzerhand in sein Haus geladen. Jemanden von hohem Stande hatte er kaum auf der Straße stehen lassen können. Der Dorfvorsteher überlegt kurz. Als Magus Gernot Leomar Galdifei aus, von, … irgendwo, hatte er sich vorgestellt. Herr Galdifei war nicht wortkarg, er hatte den ganzen Abend über Gilden, Dispute und andere Dinge geredet. Der kleine, rundliche Mann seufzte zum dritten Mal. Er war kein guter Zuhörer gewesen. Immer wieder waren seine Gedanken um den „Fluch“, der über ihnen lag, gekreist. Er glaubte nicht wirklich, an eine Verhexung oder deren gleichen, aber was es auch war, es bedrohte ihre Existenz. Möglicher Weise hatten die Götter diesen Magier geschickt und er konnte der Sache auf den Grund gehen. Im Augenblick jedoch stand der Magus still lauschend am Fenster, während die Händler ihren Streit auf handfestere Weise verlegt hatten. Sie prügelten sich. Nurbart seufzte.Nurbart hob seinen Blick und musterte den Fremdling. Die große und durchaus hagere Gestalt des jungen Mannes wirkte ein wenig gebrechlich unter dem hellen, weiten Reisegewand. Eine einfach geflochtene Kordel hielt den Stoff um die Taille zusammen und diente gleichzeitig einer schmucklosen, ledernen Dolchscheide als Befestigung. Abgetragene, leichte Lederstiefel lugten unter dem vom Staub der Straße verschmutzten Saum des Gewands hervor. Seine linke Hand, blass und feingliedrig, umschloss locker einen kunstvoll verzierten Stab aus dunklem Holz. Ein von einer filigranen Silberspange gehaltener Umhang mit eingestickten silbernen Symbolen erweckte den Anschein, als würde der weiche, dunkelblaue Stoff von innen heraus schimmern. Im Vergleich zu seinem Gewand war der Umhang makellos und peinlichst gepflegt. Das Gesicht, eingerahmt von leicht gewellten, schulterlangen, nachtschwarzen Haar, einem gepflegten Kinnbart und einem gezwirbelten Schnauzer, war von vornehmer Blässe. Hohe Wangenknochen und eine schlanke Nase verliehen ihm scharf geschnittene, kantige Züge. Der Mann war vor zwei Tagen im Dorf eingetroffen. Einer der vielen, die die Abzweigung der Hauptstraße verpasst hatten und in Farhain eine Unterkunft gesucht hatte. Da das Gasthaus geschlossen war, hatte Nurbart den Mann kurzerhand in sein Haus geladen. Jemanden von hohem Stande hatte er kaum auf der Straße stehen lassen können. Der Dorfvorsteher überlegt kurz. Als Magus Gernot Leomar Galdifei aus, von, … irgendwo, hatte er sich vorgestellt. Herr Galdifei war nicht wortkarg, er hatte den ganzen Abend über Gilden, Dispute und andere Dinge geredet. Der kleine, rundliche Mann seufzte zum dritten Mal. Er war kein guter Zuhörer gewesen. Immer wieder waren seine Gedanken um den „Fluch“, der über ihnen lag, gekreist. Er glaubte nicht wirklich, an eine Verhexung oder deren gleichen, aber was es auch war, es bedrohte ihre Existenz. Möglicher Weise hatten die Götter diesen Magier geschickt und er konnte der Sache auf den Grund gehen. Im Augenblick jedoch stand der Magus still lauschend am Fenster, während die Händler ihren Streit auf handfestere Weise verlegt hatten. Sie prügelten sich. Nurbart seufzte.
Nurbart hob seinen Blick und musterte den Fremdling. Die große und durchaus hagere Gestalt des jungen Mannes wirkte ein wenig gebrechlich unter dem hellen, weiten Reisegewand. Eine einfach geflochtene Kordel hielt den Stoff um die Taille zusammen und diente gleichzeitig einer schmucklosen, ledernen Dolchscheide als Befestigung. Abgetragene, leichte Lederstiefel lugten unter dem vom Staub der Straße verschmutzten Saum des Gewands hervor. Seine linke Hand, blass und feingliedrig, umschloss locker einen kunstvoll verzierten Stab aus dunklem Holz. Ein von einer filigranen Silberspange gehaltener Umhang mit eingestickten silbernen Symbolen erweckte den Anschein, als würde der weiche, dunkelblaue Stoff von innen heraus schimmern. Im Vergleich zu seinem Gewand war der Umhang makellos und peinlichst gepflegt. Das Gesicht, eingerahmt von leicht gewellten, schulterlangen, nachtschwarzen Haar, einem gepflegten Kinnbart und einem gezwirbelten Schnauzer, war von vornehmer Blässe. Hohe Wangenknochen und eine schlanke Nase verliehen ihm scharf geschnittene, kantige Züge. Der Mann war vor zwei Tagen im Dorf eingetroffen. Einer der vielen, die die Abzweigung der Hauptstraße verpasst hatten und in Farhain eine Unterkunft gesucht hatte. Da das Gasthaus geschlossen war, hatte Nurbart den Mann kurzerhand in sein Haus geladen. Jemanden von hohem Stande hatte er kaum auf der Straße stehen lassen können. Der Dorfvorsteher überlegt kurz. Als Magus Gernot Leomar Galdifei aus, von, … irgendwo, hatte er sich vorgestellt. Herr Galdifei war nicht wortkarg, er hatte den ganzen Abend über Gilden, Dispute und andere Dinge geredet. Der kleine, rundliche Mann seufzte zum dritten Mal. Er war kein guter Zuhörer gewesen. Immer wieder waren seine Gedanken um den „Fluch“, der über ihnen lag, gekreist. Er glaubte nicht wirklich, an eine Verhexung oder deren gleichen, aber was es auch war, es bedrohte ihre Existenz. Möglicher Weise hatten die Götter diesen Magier geschickt und er konnte der Sache auf den Grund gehen. Im Augenblick jedoch stand der Magus still lauschend am Fenster, während die Händler ihren Streit auf handfestere Weise verlegt hatten. Sie prügelten sich. Nurbart seufzte.Nurbart hob seinen Blick und musterte den Fremdling. Die große und durchaus hagere Gestalt des jungen Mannes wirkte ein wenig gebrechlich unter dem hellen, weiten Reisegewand. Eine einfach geflochtene Kordel hielt den Stoff um die Taille zusammen und diente gleichzeitig einer schmucklosen, ledernen Dolchscheide als Befestigung. Abgetragene, leichte Lederstiefel lugten unter dem vom Staub der Straße verschmutzten Saum des Gewands hervor. Seine linke Hand, blass und feingliedrig, umschloss locker einen kunstvoll verzierten Stab aus dunklem Holz. Ein von einer filigranen Silberspange gehaltener Umhang mit eingestickten silbernen Symbolen erweckte den Anschein, als würde der weiche, dunkelblaue Stoff von innen heraus schimmern. Im Vergleich zu seinem Gewand war der Umhang makellos und peinlichst gepflegt. Das Gesicht, eingerahmt von leicht gewellten, schulterlangen, nachtschwarzen Haar, einem gepflegten Kinnbart und einem gezwirbelten Schnauzer, war von vornehmer Blässe. Hohe Wangenknochen und eine schlanke Nase verliehen ihm scharf geschnittene, kantige Züge. Der Mann war vor zwei Tagen im Dorf eingetroffen. Einer der vielen, die die Abzweigung der Hauptstraße verpasst hatten und in Farhain eine Unterkunft gesucht hatte. Da das Gasthaus geschlossen war, hatte Nurbart den Mann kurzerhand in sein Haus geladen. Jemanden von hohem Stande hatte er kaum auf der Straße stehen lassen können. Der Dorfvorsteher überlegt kurz. Als Magus Gernot Leomar Galdifei aus, von, … irgendwo, hatte er sich vorgestellt. Herr Galdifei war nicht wortkarg, er hatte den ganzen Abend über Gilden, Dispute und andere Dinge geredet. Der kleine, rundliche Mann seufzte zum dritten Mal. Er war kein guter Zuhörer gewesen. Immer wieder waren seine Gedanken um den „Fluch“, der über ihnen lag, gekreist. Er glaubte nicht wirklich, an eine Verhexung oder deren gleichen, aber was es auch war, es bedrohte ihre Existenz. Möglicher Weise hatten die Götter diesen Magier geschickt und er konnte der Sache auf den Grund gehen. Im Augenblick jedoch stand der Magus still lauschend am Fenster, während die Händler ihren Streit auf handfestere Weise verlegt hatten. Sie prügelten sich. Nurbart seufzte.
 20.Eintrag
20.Eintrag
 Brandur betrachtet die Fenster der umliegenden Häuser. Er hoffte, einen neugierigen Kopf oder ein paar Bewegungen in den Behausungen zu erkennen. Wenn schon keine Kinder, dann vielleicht ältere Dorfbewohner, die Fremde misstrauisch aus ihren Häusern beobachteten. Vollkommen verlassen schien das Dorf nicht zu sein. Es wirkte sehr gepflegt, keine Trümmer, keine überwuchernden Pflanzen, keine Anzeichen eines Überfalles. Alles war am rechten Platz. Und es kamen Geräusche aus der Schmiede. Brandur schnüffelt mit seiner großen Nase. Boradin stieß ihn unvermittelt in die Seite. Ein stechender Schmerz durchfuhr Brandur. Seine Rippen pochten und das Brennen seines Armes rief intensiv den üblen Bruch in sein Bewusstsein zurück. „Na Du klapperndes Zwergengestell“, brummt Boradin, „lass uns in diese Taverne stürmen, das Bier leeren und Dir einen anständigen Heiler suchen. Ich hab das Gefühl, wir brauchen Deinen Arm schnell stark und in einem Stück.“ Brandur warf Boradin aus kleinen stechenden Augen einen rauflustigen Blick zu. Hatte dieser ihn grade als unbrauchbar beschrieben. Boradin zog die Luft ein, streckte sich zur vollen Größe und lachte los. Seine Bartringe schepperten. „Beim Zwergenvater, lass stecken, die Rauferei kommt doch erst nach dem Bier!“ Brandur grummelte, brummelte, schmunzelte und lachte mit, auch wenn seine Rippen das weniger gut fanden. „Ich werde Dir einen Deiner Ringe durch die Nase ziehen, Du Sprücheklopfer!“ Mit diesen Worten stapften beide Zwerge Seite an Seite auf die Taverne zu. Boradin dreht sich um und forderte die anderen mit einem Wink zum Folgen auf. Wäre noch jemand hinter ihnen gewesen.
Brandur betrachtet die Fenster der umliegenden Häuser. Er hoffte, einen neugierigen Kopf oder ein paar Bewegungen in den Behausungen zu erkennen. Wenn schon keine Kinder, dann vielleicht ältere Dorfbewohner, die Fremde misstrauisch aus ihren Häusern beobachteten. Vollkommen verlassen schien das Dorf nicht zu sein. Es wirkte sehr gepflegt, keine Trümmer, keine überwuchernden Pflanzen, keine Anzeichen eines Überfalles. Alles war am rechten Platz. Und es kamen Geräusche aus der Schmiede. Brandur schnüffelt mit seiner großen Nase. Boradin stieß ihn unvermittelt in die Seite. Ein stechender Schmerz durchfuhr Brandur. Seine Rippen pochten und das Brennen seines Armes rief intensiv den üblen Bruch in sein Bewusstsein zurück. „Na Du klapperndes Zwergengestell“, brummt Boradin, „lass uns in diese Taverne stürmen, das Bier leeren und Dir einen anständigen Heiler suchen. Ich hab das Gefühl, wir brauchen Deinen Arm schnell stark und in einem Stück.“ Brandur warf Boradin aus kleinen stechenden Augen einen rauflustigen Blick zu. Hatte dieser ihn grade als unbrauchbar beschrieben. Boradin zog die Luft ein, streckte sich zur vollen Größe und lachte los. Seine Bartringe schepperten. „Beim Zwergenvater, lass stecken, die Rauferei kommt doch erst nach dem Bier!“ Brandur grummelte, brummelte, schmunzelte und lachte mit, auch wenn seine Rippen das weniger gut fanden. „Ich werde Dir einen Deiner Ringe durch die Nase ziehen, Du Sprücheklopfer!“ Mit diesen Worten stapften beide Zwerge Seite an Seite auf die Taverne zu. Boradin dreht sich um und forderte die anderen mit einem Wink zum Folgen auf. Wäre noch jemand hinter ihnen gewesen.
 Seylina und Nijura waren bereits ein ganzes Stück weiter links zu der kleinen Bruchsteinhütte unterwegs, neben der das schwarze Pferd graste. Charie war zurückgeblieben und musterte die Häuser am Eingang des Dorfes. Besonders der Kräutergarten mit dem kleinen Zaun, hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Boradin brummte: „Sollen wir warten?“ Ein kurzer Blick, ein verächtliches Grunzen und Brandur steuert zielstrebig weiter auf den Eingang der Gaststätte zu. Er hatte genug von schwarzen, großen Tieren. Eine warme Mahlzeit, ein oder besser drei Bier und ein ordentlicher Schlafplatz waren sein Ziel. Dem großen Geheimnis konnte man später immer noch nachgehen. Da niemand da war, konnte auch niemand weglaufen. Außerdem waren Tavernen meist die besten Anlaufstellen für Neuigkeiten und Geschichten. Sein Vorsatz endete jäh an einem quer über die Tür genageltem Holzschild: „Auf unbestimmte Zeit geschlossen.“ Ein schweres Vorhängeschloss verdeutlichte die Situation. Boradin strich sich sorgenvoll durch seinen Bart. „Ist das Gasthaus zu, ist es schlimm. Mächtig schlimm. Um nicht zu sagen, böse!“
Seylina und Nijura waren bereits ein ganzes Stück weiter links zu der kleinen Bruchsteinhütte unterwegs, neben der das schwarze Pferd graste. Charie war zurückgeblieben und musterte die Häuser am Eingang des Dorfes. Besonders der Kräutergarten mit dem kleinen Zaun, hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Boradin brummte: „Sollen wir warten?“ Ein kurzer Blick, ein verächtliches Grunzen und Brandur steuert zielstrebig weiter auf den Eingang der Gaststätte zu. Er hatte genug von schwarzen, großen Tieren. Eine warme Mahlzeit, ein oder besser drei Bier und ein ordentlicher Schlafplatz waren sein Ziel. Dem großen Geheimnis konnte man später immer noch nachgehen. Da niemand da war, konnte auch niemand weglaufen. Außerdem waren Tavernen meist die besten Anlaufstellen für Neuigkeiten und Geschichten. Sein Vorsatz endete jäh an einem quer über die Tür genageltem Holzschild: „Auf unbestimmte Zeit geschlossen.“ Ein schweres Vorhängeschloss verdeutlichte die Situation. Boradin strich sich sorgenvoll durch seinen Bart. „Ist das Gasthaus zu, ist es schlimm. Mächtig schlimm. Um nicht zu sagen, böse!“
 Für Seylina strahlte die ganze Umgebung Trostlosigkeit, gar Hoffnungslosigkeit aus. Sie war keine Expertin menschlicher, kleiner Ansiedlungen, aber dieses einsame Dorf entsprach keiner der Erzählungen. Der größte Kontrast zur der gestörten Natur war der kräftige, schwarze Hengst. Er strotzte vor Leben. Angebunden war er nicht. Kein Zaumzeug, kein Sattel, keine Decke, kein Hinweis auf seinen Besitzer. Die Spuren in seiner Nähe zeigten Hufeisen. Beschlagen war er. Behutsam näherte sich die Waldelfe, dicht gefolgt von Nijura. Der Hengst hob den Kopf, spielte mit seinen Ohren. Seylina verlangsamte ihre Schritte, beobachtet sorgsam die Hütte ohne das stattliche Tier aus den Augen zu lassen. Der Hengst schnaubte einmal laut, senkte sein Haupt und suchte das nächste saftig grüne Büschel Gras. Nijura flüsterte leise über Seylinas Schulter: „Angst hat er keine. Er ist an Menschen gewöhnt. Ich würde sagen, er hat eine gute Ausbildung bekommen, möglicher Weise sogar für eine Schlacht. Seht ihr seine Haltung. Sie ist vollkommen entspannt. Als ob, …“ Die Waldläuferin hielt mitten im Satz inne. Beide Frauen blieben wie angewurzelt stehen. Hinter dem aufgestapelten Holzhaufen am Rande der Hütte war ein anderes Tier erschienen. Schneeweiß stand der imposante, fast hüftgroße Wolf keine drei Schritt von dem Rappen entfernt. Sein Blick fixierte die zwei, die Lefzen zurückgezogen, die großen Fangzähne entblößt, die muskulösen Schultern spielten, die Hinterläufe zum Sprung bereit, das Fell gesträubt. Ein tiefes, bedrohliches Knurren drang aus seiner Kehle. Der Hengst rupfte seelenruhig ein paar gelbe Blumen.
Für Seylina strahlte die ganze Umgebung Trostlosigkeit, gar Hoffnungslosigkeit aus. Sie war keine Expertin menschlicher, kleiner Ansiedlungen, aber dieses einsame Dorf entsprach keiner der Erzählungen. Der größte Kontrast zur der gestörten Natur war der kräftige, schwarze Hengst. Er strotzte vor Leben. Angebunden war er nicht. Kein Zaumzeug, kein Sattel, keine Decke, kein Hinweis auf seinen Besitzer. Die Spuren in seiner Nähe zeigten Hufeisen. Beschlagen war er. Behutsam näherte sich die Waldelfe, dicht gefolgt von Nijura. Der Hengst hob den Kopf, spielte mit seinen Ohren. Seylina verlangsamte ihre Schritte, beobachtet sorgsam die Hütte ohne das stattliche Tier aus den Augen zu lassen. Der Hengst schnaubte einmal laut, senkte sein Haupt und suchte das nächste saftig grüne Büschel Gras. Nijura flüsterte leise über Seylinas Schulter: „Angst hat er keine. Er ist an Menschen gewöhnt. Ich würde sagen, er hat eine gute Ausbildung bekommen, möglicher Weise sogar für eine Schlacht. Seht ihr seine Haltung. Sie ist vollkommen entspannt. Als ob, …“ Die Waldläuferin hielt mitten im Satz inne. Beide Frauen blieben wie angewurzelt stehen. Hinter dem aufgestapelten Holzhaufen am Rande der Hütte war ein anderes Tier erschienen. Schneeweiß stand der imposante, fast hüftgroße Wolf keine drei Schritt von dem Rappen entfernt. Sein Blick fixierte die zwei, die Lefzen zurückgezogen, die großen Fangzähne entblößt, die muskulösen Schultern spielten, die Hinterläufe zum Sprung bereit, das Fell gesträubt. Ein tiefes, bedrohliches Knurren drang aus seiner Kehle. Der Hengst rupfte seelenruhig ein paar gelbe Blumen.
 Charie war zurückgeblieben und beobachtete ihre Gefährten. Klar, die Zwerge strebten zielstrebig dem Wirtshaus entgegen. Wer hätte je daran gezweifelt, dass dies nicht deren erste Wahl gewesen wäre. Die anderen beiden hatte Interesse an dem ansehnlichen Rappen gefunden. Aber wollten sie nicht als erstes den Dorfvorsteher suchen? „Sag mal Buck, wo glaubst Du, wird sich Herr Nurbart jetzt aufhalten?“ Buck trat neben Charie und wischte verlegen mit dem Fuß über den Boden. „Buck weiß so was nicht“, antwortete er seufzend. „Aber Buck weiß, wo er wohnt!“. Mit diesen Worten zeigte er auf das große Fachwerkhaus. Charie nickte, wie zur eigenen Bestätigung. Ein Wappen am Tor bezeichnete bei den Menschen meist ein wichtigeres Gebäude. „Und warum ist niemand zu sehen?“ Buck verzog irritiert das Gesicht. „Buck sieht Leute. Die alten Kinder schubsen sich vor dem Gasthaus, die schöne und die kräftige Frau stehen gaaanz still vor dem Haus der, … der, … Frau die Geschichten singt und hinter uns hat die dünne Aera aus dem Fenster geschielt. Wo andere sind …“, Buck zuckte mit den Schultern und lies sie traurig hängen. „Buck ist dumme Hilfe.“ Charie legte tröstend eine Hand an seinen Arm. “Ganz im Gegenteil. Wo wohnt Aera? Wenn sie uns gesehen hat, sollte wir sie begrüßen, oder nicht?“ Buck schaute in Charies Augen. „Wie Teich im Wald, wenn Mond zweimal da!“ murmelte der grobschlächtige Bursche. „Was meinst Du?“ Charie zog leicht irritiert die Stirn kraus in Falten. „Jetzt ist Stein in Teich gefallen“, antwortete Buck. Ohne weitere Worte, dreht sich der große Kerl um und schlurfte den Weg zurück, den sie gekommen waren. „Aera lebt da hinten, bei den vielen bunten Blumen.“
Charie war zurückgeblieben und beobachtete ihre Gefährten. Klar, die Zwerge strebten zielstrebig dem Wirtshaus entgegen. Wer hätte je daran gezweifelt, dass dies nicht deren erste Wahl gewesen wäre. Die anderen beiden hatte Interesse an dem ansehnlichen Rappen gefunden. Aber wollten sie nicht als erstes den Dorfvorsteher suchen? „Sag mal Buck, wo glaubst Du, wird sich Herr Nurbart jetzt aufhalten?“ Buck trat neben Charie und wischte verlegen mit dem Fuß über den Boden. „Buck weiß so was nicht“, antwortete er seufzend. „Aber Buck weiß, wo er wohnt!“. Mit diesen Worten zeigte er auf das große Fachwerkhaus. Charie nickte, wie zur eigenen Bestätigung. Ein Wappen am Tor bezeichnete bei den Menschen meist ein wichtigeres Gebäude. „Und warum ist niemand zu sehen?“ Buck verzog irritiert das Gesicht. „Buck sieht Leute. Die alten Kinder schubsen sich vor dem Gasthaus, die schöne und die kräftige Frau stehen gaaanz still vor dem Haus der, … der, … Frau die Geschichten singt und hinter uns hat die dünne Aera aus dem Fenster geschielt. Wo andere sind …“, Buck zuckte mit den Schultern und lies sie traurig hängen. „Buck ist dumme Hilfe.“ Charie legte tröstend eine Hand an seinen Arm. “Ganz im Gegenteil. Wo wohnt Aera? Wenn sie uns gesehen hat, sollte wir sie begrüßen, oder nicht?“ Buck schaute in Charies Augen. „Wie Teich im Wald, wenn Mond zweimal da!“ murmelte der grobschlächtige Bursche. „Was meinst Du?“ Charie zog leicht irritiert die Stirn kraus in Falten. „Jetzt ist Stein in Teich gefallen“, antwortete Buck. Ohne weitere Worte, dreht sich der große Kerl um und schlurfte den Weg zurück, den sie gekommen waren. „Aera lebt da hinten, bei den vielen bunten Blumen.“
 Zur gleichen Zeit kämpfte Aera Pan, hin und her gerissen zwischen ihrer Neugier über die Fremden und ihrer Angst sich zu zeigen. Vielleicht waren diese Wesen der Grund für all das Übel. Waren gekommen, um ihr Werk der Zerstörung zu vollenden. Aera schüttelt den Kopf. Es war eine Waldläuferin dabei. Edda hatte immer von diesen Menschen gesungen. Wie wichtig sie für das Dorf waren und wie sie mit der Natur zusammen lebten. Franzibian hat diese Wanderer oft zu ihnen eingeladen und sich über die neueste Kunde aus dem Reich, über Kräuter oder Tiere unterhalten. Am Anfang fand Aera sie alle irgendwie sonderbar. Nach und nach verstand sie ihre Art immer besser. Möglicher Weise konnte diese Frau ihr helfen. Aber warum war sie mit so seltsamen Kreaturen zusammen. Die meisten Waldläufer waren Einzelgänger. „Ach, ich bring mich um meinen eigenen Verstand“, fauchte sie. „Ich werde keinesfalls sitzen bleiben und warten. Ich geh jetzt nach draußen, kümmere mich leise um den Garten und kann die Unbekannten heimlich belauschen.“ Ihr Vorhaben in die Tat umsetzend, griff das junge Mädchen nach einem Erdstachel, einer kleinen Sichel und dem Erntebeutel. Einmal tief durchatmend, streckte sie die Hand zum Türgriff, zögerte, zog vorsichtig an der Tür und vernahm das verräterische Knarren des Holzes. Aera bekam eine Gänsehaut. Das musste man bis zur Straße gehört haben. Egal. Mit einem energischen Ruck öffnete sie die Tür. Das leise Knarren wurde zum Ächzen. Mutig trat sie in das Sonnenlicht. Es war grell. Sie blinzelte, hob die Hand mit der Tasche, um ihre Augen zu schützen. „Du musst Aera sein?“ klang eine melodische, sanfte Stimme an ihr Ohr. Aera gefror das Blut in den Adern. Keine fünf Schritt vor ihr stand eines dieser Wesen und hatte sie angesprochen. Direkt, ohne Vorwarnung.
Zur gleichen Zeit kämpfte Aera Pan, hin und her gerissen zwischen ihrer Neugier über die Fremden und ihrer Angst sich zu zeigen. Vielleicht waren diese Wesen der Grund für all das Übel. Waren gekommen, um ihr Werk der Zerstörung zu vollenden. Aera schüttelt den Kopf. Es war eine Waldläuferin dabei. Edda hatte immer von diesen Menschen gesungen. Wie wichtig sie für das Dorf waren und wie sie mit der Natur zusammen lebten. Franzibian hat diese Wanderer oft zu ihnen eingeladen und sich über die neueste Kunde aus dem Reich, über Kräuter oder Tiere unterhalten. Am Anfang fand Aera sie alle irgendwie sonderbar. Nach und nach verstand sie ihre Art immer besser. Möglicher Weise konnte diese Frau ihr helfen. Aber warum war sie mit so seltsamen Kreaturen zusammen. Die meisten Waldläufer waren Einzelgänger. „Ach, ich bring mich um meinen eigenen Verstand“, fauchte sie. „Ich werde keinesfalls sitzen bleiben und warten. Ich geh jetzt nach draußen, kümmere mich leise um den Garten und kann die Unbekannten heimlich belauschen.“ Ihr Vorhaben in die Tat umsetzend, griff das junge Mädchen nach einem Erdstachel, einer kleinen Sichel und dem Erntebeutel. Einmal tief durchatmend, streckte sie die Hand zum Türgriff, zögerte, zog vorsichtig an der Tür und vernahm das verräterische Knarren des Holzes. Aera bekam eine Gänsehaut. Das musste man bis zur Straße gehört haben. Egal. Mit einem energischen Ruck öffnete sie die Tür. Das leise Knarren wurde zum Ächzen. Mutig trat sie in das Sonnenlicht. Es war grell. Sie blinzelte, hob die Hand mit der Tasche, um ihre Augen zu schützen. „Du musst Aera sein?“ klang eine melodische, sanfte Stimme an ihr Ohr. Aera gefror das Blut in den Adern. Keine fünf Schritt vor ihr stand eines dieser Wesen und hatte sie angesprochen. Direkt, ohne Vorwarnung.
 Ein Gespräch ganz anderer Art lief im ersten Stock vom Dorfvorsteher Nurbart ab. Die Händlerin Pfaffi duckte sich grade unter einen Kopfschwinger von Vilfinger hindurch, während sie ihr Gewicht für einen anständigen Fußfeger verlagerte. Leomar hatte der Rauferei ein paar Augenblicke zugeschaut. Gewalt war so eine lächerliche Art der Demonstration. Mit beschwichtigenden Worten redete er auf die beiden Streithähne ein: „Bitte, meine Herren, wir sind hier nicht bei den Ogern!“ Auf der anderen Seite des Raumes hob Herr Nurbart ansatzweise seine Hand. Der Magier hätte dies als Warnung verstehen können, hätte er nicht dem Geschoss in Form einer kleinen Vase ausweichen müssen. „Das ist wieder das Letzte. Meine „Herren“, sagt der aufgetakelte Fremde da. Keine Ahnung von irgendwas. Nicht mal Männlein und Weiblein kann er unterscheiden.“ Pfaffi griff zum nächstbesten werfbaren Gegenstand. Vilfinger nutze die Gelegenheit für einen gezielten Hieb in die Seite seiner Gegnerin. Diese sackte leicht in sich zusammen und rang nach Luft. Leomar sah seine Chance: "Wir sind doch zivilisiert genug unsere Differenzen argumentativ auf Grundlage sachlicher Diskussion beizulegen." „Nicht das Buch“, schrie Nurbart entsetzt. Es war zu spät. Pfaffi hatte Vilfinger ihren Ellbogen ins Gesicht gedroschen und mit der rechten freien Hand ein mittelgroßes, in Leder eingebundenes Buch in Richtung des Zauberers geschleudert. Der Wurf war schlecht. Leomar hatte seine Position längst verlassen und war auf dem Weg zu Nurbart, während das wertvolle Objekt mit lautem Klirren durch das teure Glasfenster nach draußen verschwand. „Jetzt hat er den Beweis, dass Du ein Weib bist. Kannst nicht werfen!“, spottete Vilfinger. Einen Herzschlag darauf, verzogen sich seine Gesichtszüge zu einer schmerzverzerrten Grimasse. Die Händlerin hatte einen perfekten Tritt gegen sein Schienbein gelandet.
Ein Gespräch ganz anderer Art lief im ersten Stock vom Dorfvorsteher Nurbart ab. Die Händlerin Pfaffi duckte sich grade unter einen Kopfschwinger von Vilfinger hindurch, während sie ihr Gewicht für einen anständigen Fußfeger verlagerte. Leomar hatte der Rauferei ein paar Augenblicke zugeschaut. Gewalt war so eine lächerliche Art der Demonstration. Mit beschwichtigenden Worten redete er auf die beiden Streithähne ein: „Bitte, meine Herren, wir sind hier nicht bei den Ogern!“ Auf der anderen Seite des Raumes hob Herr Nurbart ansatzweise seine Hand. Der Magier hätte dies als Warnung verstehen können, hätte er nicht dem Geschoss in Form einer kleinen Vase ausweichen müssen. „Das ist wieder das Letzte. Meine „Herren“, sagt der aufgetakelte Fremde da. Keine Ahnung von irgendwas. Nicht mal Männlein und Weiblein kann er unterscheiden.“ Pfaffi griff zum nächstbesten werfbaren Gegenstand. Vilfinger nutze die Gelegenheit für einen gezielten Hieb in die Seite seiner Gegnerin. Diese sackte leicht in sich zusammen und rang nach Luft. Leomar sah seine Chance: "Wir sind doch zivilisiert genug unsere Differenzen argumentativ auf Grundlage sachlicher Diskussion beizulegen." „Nicht das Buch“, schrie Nurbart entsetzt. Es war zu spät. Pfaffi hatte Vilfinger ihren Ellbogen ins Gesicht gedroschen und mit der rechten freien Hand ein mittelgroßes, in Leder eingebundenes Buch in Richtung des Zauberers geschleudert. Der Wurf war schlecht. Leomar hatte seine Position längst verlassen und war auf dem Weg zu Nurbart, während das wertvolle Objekt mit lautem Klirren durch das teure Glasfenster nach draußen verschwand. „Jetzt hat er den Beweis, dass Du ein Weib bist. Kannst nicht werfen!“, spottete Vilfinger. Einen Herzschlag darauf, verzogen sich seine Gesichtszüge zu einer schmerzverzerrten Grimasse. Die Händlerin hatte einen perfekten Tritt gegen sein Schienbein gelandet.
Leomar war bei Nurbart angekommen. „Werter Nurbart, woher erwächst der Groll dieser Bürger aufeinander? Dürfte ich unter Umständen meine Dienste als Mediator anbieten. Ich bin mitnichten ein Geweihter der Wissenden Künste, aber umfassend mit Gaben der magischen Göttin gesegnet. In etlichen Fällen der Disputation konnte ich schlichten und ergebnisreich zu einem akzeptablen Einvernehmen führen.“ Nurbart starrte den Magier an. Er war überzeugt, ein einziger Schlag würde diesen Kerl ins Reich der Träume schicken. Auf der anderen Seite, er bot seine Hilfe an. Man müsste nur die Art der Hilfe in eine andere Richtung lenken. Mit einem einnehmend charmanten Lächeln wandet er sich an Leomar: „Oh, ich nehme Euer Angebot dankend an. Ihr scheint der Richtige zu sein, diesen Fluch zu untersuchen und zu brechen, der auf unserem Dorf lastet!“ „Fluch?!“, entfuhr es Leomar. „Ja – Edda behauptet, es handle sich um einen Fluch. Kein Hexenwerk im üblichen Sinne, aber in der Richtung.“ „Wie lange liegen diese Frau und dieser Mann im Streit und wer hat sie verzaubert?“, wollte Leomar wissen. „Ach die! Nein, nein, die streiten sich, seit ihrer Kindheit. So eine Art Haßliebe würde ich sagen. Das ist vollkommen normal.“ Nurbart seufzte wieder einmal. „Ich rede von dem giftigen Wasser, welches so viele Opfert gefordert hat! Das Dorf geht daran zugrunde. So viele sind gestorben. Unser Heiler ist Tod. Die Hälfte des Dorfes gegangen. Der Vogt verrückt. Keiner weiß Rat!“ Das scharfkantige Gesicht des Magiers nahm ernste Züge an, was ihn fast unheimlich erschienen lies. „Bei den Göttern. Sie haben mich, Magus zur Akademie der Magie aus Methumis, den rechten Weg zu hilfebedürftigen Menschen geführt, die Künste zu weisen Mitteln der Analyse und Erkenntnis einzusetzen. Durch meine langen Reisen und interdisziplinären Studien bin ich prädestiniert Euch meine volle Unterstützung zukommen zu lassen, welche arkanen Ströme oder gar hexerische Mißgestaltungen der Naturkräfte walten mögen!“ „Aha“, entfuhr es Nurbart. „Wo wollt ihr anfangen?“
Mit einem Donnern flog die Tür zum Ratszimmer auf und knallte gegen das Holz der Wand. „Genug!“ Wie ein Schlag entlud sich die Stimme einer Frau in den Raum. Die Händler verharrten in ihrer schlagenden Bewegung, Nurbart starrte mit großen Augen zur Tür, die Gastleute Kraut tuschelten leise miteinander. Die Frau war in eine tiefblaue Halbtunika gekleidet. Mehr trug sie nicht. Nicht einmal Schuhe. Sie zeigte aufreizend viel Haut. Langes schwarzes Haar viel über ihre Schultern. Ihr Gesicht war schön, trotz charaktervollen Zügen und voller Temperament. Eine Frau, die allein durch ihr Äußeres Aufmerksamkeit auf sich zog. In diesem Augenblick jedoch, so wie sie in der Tür stand, zornig, die durchtrainierten Muskeln ihres Körpers angespannt, hätte sie die Tochter des Donnergottes persönlich sein können. Ihr Finger schnellt in Leomars Richtung: „Du, Zauberer, wie gut bist Du in Heilkunst bewandert? Da stirbt eine Frau!“
 21.Eintrag
21.Eintrag
 Das Gasthaus war und blieb zu. Klopfen, Rufen und Schimpfen zeigten keine Wirkung. Ärgerlich! Gerade auf die schmerzende Rippe, innerlich und später äußerlich, hätte eine ordentliche Menge Alkohol gut getan! Die Stimmung auf dem Tiefpunkt, mit hängendem Bart und pochendem Arm kehrten Brandur und Boradin zurück auf die Straße. Das Elfen sich, immer verdrücken müssen, wenn es darum ging etwas Wichtiges zu finden. Bei dem sich bietenden Anblick der Damen an der kleinen Hütte kehrte Brandurs Stimmung ein wenig zurück. Die beiden starrten das schwarze Pferd an, als würde es sie gleich verschlingen. Najiba zog im Tempo einer Grubenschnecke einen Pfeil aus ihrem Köcher, während Seylina sehr langsam zurückwich. Das musste ein schrecklicher Teufelsgaul sein. Vielleicht stanken seine Pferdeäpfel so bestialisch, dass es die feine Elfendame rückwärts taumeln ließ. Die Schmiede musste warten. Brandur wollte unbedingt diese grausige Gefahr aus der Nähe betrachten. Die Waffe wurde gezückt und er bewegte sich leise, was bei einem Zwerg seines Kalibers recht unmöglich war, zur Hütte hinüber. Boradin rümpfte die Nase, als er Brandur auf Zehenspitzen raschelnd und scheppernd zu den Elfen schleichen sah. „Wenn er nicht aufpasst, bekommt er Najibas Pfeil in den Hintern.“, dachte er. Ein kurzer Blick in die Runde und Boradin wählte ein anderes Ziel: Das hübsch gemauerte Herrenhaus mit dem Wappenschild. Wenn das nicht das Haus des Vorstehers dieses Dorfes war, dann würde er sich einen Ring aus dem Haupthaar flechten. Energischen Schrittes Schlug er die Richtung ein. „Nettes Bauwerk. Würde man es unter die Erde bringen, perfekt für eine kleine Familie seiner Sippe“, sprach er leise vor sich hin. „Die Fenster sind ein bisschen zu groß und bunt, ein paar Blumen weniger und dafür ein kleiner Anbau für eine hauseigene Werkstatt. Da könnte man was machen.“ Sind Blick fiel auf ein paar funkelnde Stück im Staub der Straße und wenn seine Augen ihn nicht täuschten, lag da ein großes Buch. Boradin hob den Kopf. Grade rechtzeitig, um den fliegenden Erdtopf auszumachen, der gradlinig auf ihn zuschoss. „Da ist zumindest was los!“, nickte er sich aufmunternd zu, zerschmetterte das Tongefäß mit einem Faustschlag in der Luft und ignorierte die sich über ihn verstreuende Erde. Er marschierte weiter auf die Eingangstür zu.
Das Gasthaus war und blieb zu. Klopfen, Rufen und Schimpfen zeigten keine Wirkung. Ärgerlich! Gerade auf die schmerzende Rippe, innerlich und später äußerlich, hätte eine ordentliche Menge Alkohol gut getan! Die Stimmung auf dem Tiefpunkt, mit hängendem Bart und pochendem Arm kehrten Brandur und Boradin zurück auf die Straße. Das Elfen sich, immer verdrücken müssen, wenn es darum ging etwas Wichtiges zu finden. Bei dem sich bietenden Anblick der Damen an der kleinen Hütte kehrte Brandurs Stimmung ein wenig zurück. Die beiden starrten das schwarze Pferd an, als würde es sie gleich verschlingen. Najiba zog im Tempo einer Grubenschnecke einen Pfeil aus ihrem Köcher, während Seylina sehr langsam zurückwich. Das musste ein schrecklicher Teufelsgaul sein. Vielleicht stanken seine Pferdeäpfel so bestialisch, dass es die feine Elfendame rückwärts taumeln ließ. Die Schmiede musste warten. Brandur wollte unbedingt diese grausige Gefahr aus der Nähe betrachten. Die Waffe wurde gezückt und er bewegte sich leise, was bei einem Zwerg seines Kalibers recht unmöglich war, zur Hütte hinüber. Boradin rümpfte die Nase, als er Brandur auf Zehenspitzen raschelnd und scheppernd zu den Elfen schleichen sah. „Wenn er nicht aufpasst, bekommt er Najibas Pfeil in den Hintern.“, dachte er. Ein kurzer Blick in die Runde und Boradin wählte ein anderes Ziel: Das hübsch gemauerte Herrenhaus mit dem Wappenschild. Wenn das nicht das Haus des Vorstehers dieses Dorfes war, dann würde er sich einen Ring aus dem Haupthaar flechten. Energischen Schrittes Schlug er die Richtung ein. „Nettes Bauwerk. Würde man es unter die Erde bringen, perfekt für eine kleine Familie seiner Sippe“, sprach er leise vor sich hin. „Die Fenster sind ein bisschen zu groß und bunt, ein paar Blumen weniger und dafür ein kleiner Anbau für eine hauseigene Werkstatt. Da könnte man was machen.“ Sind Blick fiel auf ein paar funkelnde Stück im Staub der Straße und wenn seine Augen ihn nicht täuschten, lag da ein großes Buch. Boradin hob den Kopf. Grade rechtzeitig, um den fliegenden Erdtopf auszumachen, der gradlinig auf ihn zuschoss. „Da ist zumindest was los!“, nickte er sich aufmunternd zu, zerschmetterte das Tongefäß mit einem Faustschlag in der Luft und ignorierte die sich über ihn verstreuende Erde. Er marschierte weiter auf die Eingangstür zu.
 Seylinas Gedanken arbeiteten blitzschnell. Ihr angeborener Instinkt ließen sie ohne jegliche körperliche Drohgebärde in unmerkbar fließenden Bewegungen zurückweichen. Sie sprach leise, behutsam, in ihrer Muttersprache auf die Tiere ein. Eine magische Aura baute sich auf, suchte eine Verbindung zu dem Wolf, um das Sinnen dieses fremden Wesens aufzunehmen. Was sie spürte war unverwechselbar klar: Aggression, Wut, Feindschaft und kein Funke Furcht. Diese Tier würde beim kleinsten Fehler angreifen. Warum aber stand das Pferd an seinem Platz und fraß Büschel von Gras, als ob nichts wäre. Selbst wenn die Tiere sich seit Langem kannten, würde kein Fluchttier bei dieser Drohgebärde seelenruhig bleiben. Seylina öffnete ihre Gedanken und drang weiter zum dem Raubtier vor. Das Knurren des Wolfes wurde lauter. Mit einem unvermittelten Schlag zuckte Seylina zusammen. Ihre gedankliche Verbindung war wie durch einen Hammerschlag zerbrochen worden. Najiba entging nicht die Reaktion ihrer Elfenbegleiterin. Sanft rutschte der Pfeil zurück in den Köcher. So schnell sie mit dem Bogen war, gegen die Reaktionen des Wolfes hatte sie mit dieser Waffe nicht den Hauch einer Chance. Ihre Hand wanderte zum Dolch. Die Vorderläufe des Wolfes spannten sich, kein Spiel oder Zucken war in den Ohren zu Erkennen, die Augen fixierten die Beute. Das Knurren kam aus seinem tiefsten Inneren.
Seylinas Gedanken arbeiteten blitzschnell. Ihr angeborener Instinkt ließen sie ohne jegliche körperliche Drohgebärde in unmerkbar fließenden Bewegungen zurückweichen. Sie sprach leise, behutsam, in ihrer Muttersprache auf die Tiere ein. Eine magische Aura baute sich auf, suchte eine Verbindung zu dem Wolf, um das Sinnen dieses fremden Wesens aufzunehmen. Was sie spürte war unverwechselbar klar: Aggression, Wut, Feindschaft und kein Funke Furcht. Diese Tier würde beim kleinsten Fehler angreifen. Warum aber stand das Pferd an seinem Platz und fraß Büschel von Gras, als ob nichts wäre. Selbst wenn die Tiere sich seit Langem kannten, würde kein Fluchttier bei dieser Drohgebärde seelenruhig bleiben. Seylina öffnete ihre Gedanken und drang weiter zum dem Raubtier vor. Das Knurren des Wolfes wurde lauter. Mit einem unvermittelten Schlag zuckte Seylina zusammen. Ihre gedankliche Verbindung war wie durch einen Hammerschlag zerbrochen worden. Najiba entging nicht die Reaktion ihrer Elfenbegleiterin. Sanft rutschte der Pfeil zurück in den Köcher. So schnell sie mit dem Bogen war, gegen die Reaktionen des Wolfes hatte sie mit dieser Waffe nicht den Hauch einer Chance. Ihre Hand wanderte zum Dolch. Die Vorderläufe des Wolfes spannten sich, kein Spiel oder Zucken war in den Ohren zu Erkennen, die Augen fixierten die Beute. Das Knurren kam aus seinem tiefsten Inneren.
 In Nurbarts Haus setzt sich das Durcheinander rasch wieder fort. Nachdem Pfaffi eine Bemerkung über die ungehobelte Fremde fallen gelassen hatte und dies in einem durchaus beleidigendem Zusammenhang mit der Taverne der Krauts, ging die Prügelei in größerer Runde weiter. Leomar musterte die Fremde kurz. Ob eine so offensichtlich von der Göttin der Liebe und des Krieges gesegnete Frau vielleicht auch von der Göttin der Magie bedacht worden war? Meist war dies leider nicht der Fall. Aber sie zählte definitiv zu den betrachtungswürdigen Menschen. Laut verkündete er: „Da offenbar außer mir kein magiekundiger Heiler anwesend ist, sind meine Fähigkeiten auf dem Gebiet vermutlich nicht ausschlaggebend für Eure Frage. Ich kann Euch versprechen, alles in meiner Macht stehende zu tun, um die Frau zu retten, doch dafür muss ich zuerst wissen, was ihr fehlt! Verletzungen von Waffen habe ich viele gesehenen und behandelt. Krankheiten wie die blaue Keuche sind durch die komplexeren Muster und Verknüpfungen sehr viel schwieriger zu behandeln. Was auch immer es ist, wir sollten eilen.“ Zu seiner Verblüffung lachte die Frau kurz, winkte ihm mit den Worten: „Dann hoffen wir, dass Eure Schrittfrequenz der Zahl Eurer Worte entspricht“, und wandte sich zum gehen. Leomar eilte durch den Raum, zog sein Kinn kurz vor einer langen Graden der Wirtin zurück und erreicht die rettende Tür. „Gestattet: Gernot Leomar Galdifei“ stellte er sich im Laufen vor. „Lady Zenia Zorkana, erfreut Eure Bekanntschaft zu machen“, erwiderte die Frau und deutete eine kleine Verbeugung an. Hatte Leomar die respektlose Anfrage vorhin im Zimmer auf ihre stressbedingte, mentale Unausgeglichenheit geschoben, staunte er nun über ihre galante Art. Sie eilten durch den Flur, die Treppe hinunter durch den Eingangsbereich. Zenia riss die Tür auf und hätte fast den Zwerg umgerannt, der dort mit zum Klopfen erhobener Hand den Rahmen füllte. „Zum Gruße“, brachte Boradin hervor. „Aus dem Weg“, fauchte Zorkana. „Ich bin froh, endlich jemanden gefunden zu haben. Ihr könnt nicht gleich wieder verschwinden!“, protestierte Boradin. „Ich kann!“ Leomar sah, wie die geballte Faust Zorkanas den Zwerg wie einen Baum fällte. Kein Torkeln, keine Zucken. Er kippte regungslos nach hinten um. „Ich hasse Leute, die mir im Weg stehen.“ Mit diesen Worten sprang die Frau über Boradin und rannte weiter. Leomar nahm sich fest vor, diese Worte in Erinnerung zu behalten. Er stieg über den bewusstlosen Zwerg.
In Nurbarts Haus setzt sich das Durcheinander rasch wieder fort. Nachdem Pfaffi eine Bemerkung über die ungehobelte Fremde fallen gelassen hatte und dies in einem durchaus beleidigendem Zusammenhang mit der Taverne der Krauts, ging die Prügelei in größerer Runde weiter. Leomar musterte die Fremde kurz. Ob eine so offensichtlich von der Göttin der Liebe und des Krieges gesegnete Frau vielleicht auch von der Göttin der Magie bedacht worden war? Meist war dies leider nicht der Fall. Aber sie zählte definitiv zu den betrachtungswürdigen Menschen. Laut verkündete er: „Da offenbar außer mir kein magiekundiger Heiler anwesend ist, sind meine Fähigkeiten auf dem Gebiet vermutlich nicht ausschlaggebend für Eure Frage. Ich kann Euch versprechen, alles in meiner Macht stehende zu tun, um die Frau zu retten, doch dafür muss ich zuerst wissen, was ihr fehlt! Verletzungen von Waffen habe ich viele gesehenen und behandelt. Krankheiten wie die blaue Keuche sind durch die komplexeren Muster und Verknüpfungen sehr viel schwieriger zu behandeln. Was auch immer es ist, wir sollten eilen.“ Zu seiner Verblüffung lachte die Frau kurz, winkte ihm mit den Worten: „Dann hoffen wir, dass Eure Schrittfrequenz der Zahl Eurer Worte entspricht“, und wandte sich zum gehen. Leomar eilte durch den Raum, zog sein Kinn kurz vor einer langen Graden der Wirtin zurück und erreicht die rettende Tür. „Gestattet: Gernot Leomar Galdifei“ stellte er sich im Laufen vor. „Lady Zenia Zorkana, erfreut Eure Bekanntschaft zu machen“, erwiderte die Frau und deutete eine kleine Verbeugung an. Hatte Leomar die respektlose Anfrage vorhin im Zimmer auf ihre stressbedingte, mentale Unausgeglichenheit geschoben, staunte er nun über ihre galante Art. Sie eilten durch den Flur, die Treppe hinunter durch den Eingangsbereich. Zenia riss die Tür auf und hätte fast den Zwerg umgerannt, der dort mit zum Klopfen erhobener Hand den Rahmen füllte. „Zum Gruße“, brachte Boradin hervor. „Aus dem Weg“, fauchte Zorkana. „Ich bin froh, endlich jemanden gefunden zu haben. Ihr könnt nicht gleich wieder verschwinden!“, protestierte Boradin. „Ich kann!“ Leomar sah, wie die geballte Faust Zorkanas den Zwerg wie einen Baum fällte. Kein Torkeln, keine Zucken. Er kippte regungslos nach hinten um. „Ich hasse Leute, die mir im Weg stehen.“ Mit diesen Worten sprang die Frau über Boradin und rannte weiter. Leomar nahm sich fest vor, diese Worte in Erinnerung zu behalten. Er stieg über den bewusstlosen Zwerg.
 „Na ihr beiden Kaninchen – welche Schlange hat Euch hypnotisiert.“, witzelte Brandur. „Ist das Pferd ein dämonischer Rappen?“ „Wolf“, flüsterte Najiba. Seylina registrierte in letzter Sekunde das Muskelspiel des Wolfes. Er drückte sich mit unheimlicher Schnelligkeit ab und sprang. Sie warf sich zur Seite, eine Rolle planend, um sofort in die Seite des Tieres zu gelangen. Najiba hatte weniger Glück. Der Wolf, dessen Wucht Seylina verfehlte, setzte, kaum hatten seine Füße den Boden berührt, auf sie zu. Einen Arm zum Schutz erhoben, wischte sie mit der Dolchhand in Bauchhöhe durch die Luft. Die Waffe fand keinen Widerstand. Der Wolf hatte sie im graden Sprung attackiert. Die Zähne des mächtigen Kiefers, durch den Arm abgelenkt, verfehlten knapp die Kehle seines Opfers. Die Masse des Körpers riss Najiba voller Wucht zu Boden. „Wolf!“, brüllte Brandur und griff nach seiner Axt. Im selben Augenblick erscholl ein ohrenbetäubender Knall. Der Zwerg schwankte. Ein knistern lag in der Luft. In Seylinas Augen bohrte sich ein grelles, zuckendes blauweißes Licht. Najiba versucht vergeblich, das Gewicht von sich wegzustoßen. Sie starrte in den aufgerissenen Rachen des Wolfes. Dann wurde alles schwarz.
„Na ihr beiden Kaninchen – welche Schlange hat Euch hypnotisiert.“, witzelte Brandur. „Ist das Pferd ein dämonischer Rappen?“ „Wolf“, flüsterte Najiba. Seylina registrierte in letzter Sekunde das Muskelspiel des Wolfes. Er drückte sich mit unheimlicher Schnelligkeit ab und sprang. Sie warf sich zur Seite, eine Rolle planend, um sofort in die Seite des Tieres zu gelangen. Najiba hatte weniger Glück. Der Wolf, dessen Wucht Seylina verfehlte, setzte, kaum hatten seine Füße den Boden berührt, auf sie zu. Einen Arm zum Schutz erhoben, wischte sie mit der Dolchhand in Bauchhöhe durch die Luft. Die Waffe fand keinen Widerstand. Der Wolf hatte sie im graden Sprung attackiert. Die Zähne des mächtigen Kiefers, durch den Arm abgelenkt, verfehlten knapp die Kehle seines Opfers. Die Masse des Körpers riss Najiba voller Wucht zu Boden. „Wolf!“, brüllte Brandur und griff nach seiner Axt. Im selben Augenblick erscholl ein ohrenbetäubender Knall. Der Zwerg schwankte. Ein knistern lag in der Luft. In Seylinas Augen bohrte sich ein grelles, zuckendes blauweißes Licht. Najiba versucht vergeblich, das Gewicht von sich wegzustoßen. Sie starrte in den aufgerissenen Rachen des Wolfes. Dann wurde alles schwarz.
 Da stand sie nun, schüchtern, den Beutel mit hängenden Armen schützend vor sich haltend und starrte das fremde Wesen an. Aera hatte nie zuvor eine Elfe gesehen. So vollkommen anders war sie nicht. Oder doch? Es war alles am rechten Platz, Arme, Beine, Augen, Nase, Mund, Ohren. Trotzdem umspielten die Details eine gewisse Art Andersartigkeit. Die Hände und Finger waren schlanker und länger, die Gesichtszüge merkwürdig symmetrisch, die Augen größer und schräg, die Nase, die schmalen, geschwungenen Lippen die Linie der Wangenknochen und des Kinns in fließenden Linien harmonisch perfekt aufeinander abgestimmt. Mit Körperhaltung unter Spannung, stand die Elfe dennoch locker und elegant. Sie war weiblich, sehr weiblich. Ihre offenen braunen Haare flossen um ihr Gesicht wie ein Rahmen aus poliertem Holz. Und ihre Ohren, länglich, leicht spitz zulaufend umgaben die Elfin mit einer eigenen Aura. Die Ohren! Aera fasste sich unbewusst an ihre eigenen, zerschnittenen Ohren. Eine böse Erinnerung an vergangene Tage. Ein Mal, welches sie zu tragen, viel Kraft kostete, unter Haar und Tuch gut verborgen. Das Wesen hatte sie freundlich begrüßt und hielt Abstand, lächelte und schien nichts Übles zu wollen. Oder war sie bereits verhext?
Da stand sie nun, schüchtern, den Beutel mit hängenden Armen schützend vor sich haltend und starrte das fremde Wesen an. Aera hatte nie zuvor eine Elfe gesehen. So vollkommen anders war sie nicht. Oder doch? Es war alles am rechten Platz, Arme, Beine, Augen, Nase, Mund, Ohren. Trotzdem umspielten die Details eine gewisse Art Andersartigkeit. Die Hände und Finger waren schlanker und länger, die Gesichtszüge merkwürdig symmetrisch, die Augen größer und schräg, die Nase, die schmalen, geschwungenen Lippen die Linie der Wangenknochen und des Kinns in fließenden Linien harmonisch perfekt aufeinander abgestimmt. Mit Körperhaltung unter Spannung, stand die Elfe dennoch locker und elegant. Sie war weiblich, sehr weiblich. Ihre offenen braunen Haare flossen um ihr Gesicht wie ein Rahmen aus poliertem Holz. Und ihre Ohren, länglich, leicht spitz zulaufend umgaben die Elfin mit einer eigenen Aura. Die Ohren! Aera fasste sich unbewusst an ihre eigenen, zerschnittenen Ohren. Eine böse Erinnerung an vergangene Tage. Ein Mal, welches sie zu tragen, viel Kraft kostete, unter Haar und Tuch gut verborgen. Das Wesen hatte sie freundlich begrüßt und hielt Abstand, lächelte und schien nichts Übles zu wollen. Oder war sie bereits verhext?
 Charie hatte beim ersten Anblick des dünnen, bleichen Mädchens die Angst gespürt. Wachsam hatte sie die Hütte und den Garten studiert, jedoch keinerlei Hinweise auf eine Gefahr entdeckt. Das Kind oder war es eine junge Frau, Charie hatte nach wie vor Schwierigkeiten, die kurze Lebensspanne der Menschen richtig einzuschätzen, war einfach gekleidet. Ihre blonden Haare, sauber geflochten, gaben einen interessanten Kontrast zu dem schwarzen Kopf und Halstuch, zumal ihre bernsteinfarbenen Augen dadurch auffällig leuchtend in dem Gesicht erschienen. Für einen Mensch war das Mädchen nicht hässlich. Natürlich waren die Proportionen unausgewogen, die Bewegungen schlaksig und es fehlte der innere Glanz, den ihre schnell verbrennenden Körper nie nach außen bringen konnten. Da war mehr als Angst in diesem Körper. Zorn, Wut, Selbsthass kämpften mit Güte, Hilfsbereitschaft und Neugier. Ein Ringen, welches sie lange begleiten musste. Die Elfin betrachtete den Garten und entdeckte einige, ihr bekannte Heilpflanzen. Sie ignorierte das Starren des Mädchens, deutete auf ein leicht geringeltes Kraut gelbgrüner Farbe. "Verzeih, ich wollte Dich nicht erschrecken. Ist das Lirlienkraut? Wir kommen aus Süden und hatten unterwegs eine unschöne Begegnung mit einem wildgewordenen Stier. Einer meiner Freunde ist schwer am Arm verletzt worden. Bist Du die Heilkundige dieses Dorfes?"
„Die Götter zum Gruße“ flüsterte Aera zwischen ihren Lippen kaum hörbar. Ihre Stimme klang so rau, gegen den feinen Wortgesang der Fremden. Oh je, hatte sie die ganze Zeit gestarrt. Das Mädchen räusperte sich. Das Wesen hatte sie um Hilfe gebeten. Sie hörte die mahnende Stimme ihres Vaters, nie einen hilfesuchenden Fremden abzuweisen. Nicht in leichten, aber vor allem, nie in schweren Zeiten. Sie überlegte, wie sie freundlich antworten sollte, als Buck im Hintergrund auftauchte und ihr winkte. „Buck, Du lebst!“ rief sie laut, lief rot an und ärgerte sich über sich selbst. „Buck und Herr Kasim sind gesund. Aber Zwerg Brandur hat Arm in zwei Teilen!“ Charies Lächeln wurde weicher. Buck war ideal, um das Eis zu brechen. „Nun Buck, so schlimm ist es nicht. Der Arm ist doch noch dran“, bemerkt Charie. Buck schüttelte den Kopf. „Buck hat gesehen, wie Haut grün wird und stinkt, wenn Bein nicht mehr grade.“ Aeras Interesse brach durch: „Ist der Arm gebrochen, schaut Knochen hervor?“ Buck zuckte mit den Schultern. „Buck hat nix gesehen. Aber Männlein hat erzählt, dass er wütenden Stier zum Stehen gebracht hat. Bulle ist kaputt und Arm von Zwerg auch.“ Charie unterdrückte ein Kichern. „Franzibian kann Zwergenarm flicken!“, brachte Buck mit starker Stimme hervor, als ob ihm diese Idee besonders brillant erschien. Charie wurde von einem unsäglichen Stoß der Trauer beinahe übermannt. „Buck“, meinte sie sanft und beruhigend, „ich fürchte, Franzibian ist nicht da?“ Aera rang mit Tränen, schluckte sie runter und rief schrill: „Er ist tot. Er wird nie wieder kommen. Und alles ist meine Schuld.“ Mit den Worten drehte sie sich rasch um und verschwand in der Hütte. Charies Blick wurde traurig. Das Mädchen trug die Last des Verlustes, verfolgt von anderen alten Dämonen. Charie tröstete Buck, dem auf die Nachricht vom Tod des Heilers, dicke Tränen über die Wangen kullerten. Aera beobachtet aus dem Haus heraus die liebevolle Geste und beschloss ihr Misstrauen so gut es ging, zu verdrängen. „Vielleicht hat Vater die ganze Zeit auf Besucher, wie diese gehofft, anstatt auf meine Hilfe.“ Aber sie würde sich beweisen. Sie würde sich Franzibian als würdige erweisen. Eilig suchte sie alle greifbaren Heilmittel zusammen und trat wieder ins Freie. „Ich helfe Euch“, nickte sie der Elfe zu. „Und ihr helft uns!“ Die Bestimmtheit in den Worten Aeras ließ Charie aufhorchen. Die beiden gingen Seite an Seite in Richtung Brunnen. Buck trottete leise schniefend hinterher.
Charie hatte beim ersten Anblick des dünnen, bleichen Mädchens die Angst gespürt. Wachsam hatte sie die Hütte und den Garten studiert, jedoch keinerlei Hinweise auf eine Gefahr entdeckt. Das Kind oder war es eine junge Frau, Charie hatte nach wie vor Schwierigkeiten, die kurze Lebensspanne der Menschen richtig einzuschätzen, war einfach gekleidet. Ihre blonden Haare, sauber geflochten, gaben einen interessanten Kontrast zu dem schwarzen Kopf und Halstuch, zumal ihre bernsteinfarbenen Augen dadurch auffällig leuchtend in dem Gesicht erschienen. Für einen Mensch war das Mädchen nicht hässlich. Natürlich waren die Proportionen unausgewogen, die Bewegungen schlaksig und es fehlte der innere Glanz, den ihre schnell verbrennenden Körper nie nach außen bringen konnten. Da war mehr als Angst in diesem Körper. Zorn, Wut, Selbsthass kämpften mit Güte, Hilfsbereitschaft und Neugier. Ein Ringen, welches sie lange begleiten musste. Die Elfin betrachtete den Garten und entdeckte einige, ihr bekannte Heilpflanzen. Sie ignorierte das Starren des Mädchens, deutete auf ein leicht geringeltes Kraut gelbgrüner Farbe. "Verzeih, ich wollte Dich nicht erschrecken. Ist das Lirlienkraut? Wir kommen aus Süden und hatten unterwegs eine unschöne Begegnung mit einem wildgewordenen Stier. Einer meiner Freunde ist schwer am Arm verletzt worden. Bist Du die Heilkundige dieses Dorfes?"
„Die Götter zum Gruße“ flüsterte Aera zwischen ihren Lippen kaum hörbar. Ihre Stimme klang so rau, gegen den feinen Wortgesang der Fremden. Oh je, hatte sie die ganze Zeit gestarrt. Das Mädchen räusperte sich. Das Wesen hatte sie um Hilfe gebeten. Sie hörte die mahnende Stimme ihres Vaters, nie einen hilfesuchenden Fremden abzuweisen. Nicht in leichten, aber vor allem, nie in schweren Zeiten. Sie überlegte, wie sie freundlich antworten sollte, als Buck im Hintergrund auftauchte und ihr winkte. „Buck, Du lebst!“ rief sie laut, lief rot an und ärgerte sich über sich selbst. „Buck und Herr Kasim sind gesund. Aber Zwerg Brandur hat Arm in zwei Teilen!“ Charies Lächeln wurde weicher. Buck war ideal, um das Eis zu brechen. „Nun Buck, so schlimm ist es nicht. Der Arm ist doch noch dran“, bemerkt Charie. Buck schüttelte den Kopf. „Buck hat gesehen, wie Haut grün wird und stinkt, wenn Bein nicht mehr grade.“ Aeras Interesse brach durch: „Ist der Arm gebrochen, schaut Knochen hervor?“ Buck zuckte mit den Schultern. „Buck hat nix gesehen. Aber Männlein hat erzählt, dass er wütenden Stier zum Stehen gebracht hat. Bulle ist kaputt und Arm von Zwerg auch.“ Charie unterdrückte ein Kichern. „Franzibian kann Zwergenarm flicken!“, brachte Buck mit starker Stimme hervor, als ob ihm diese Idee besonders brillant erschien. Charie wurde von einem unsäglichen Stoß der Trauer beinahe übermannt. „Buck“, meinte sie sanft und beruhigend, „ich fürchte, Franzibian ist nicht da?“ Aera rang mit Tränen, schluckte sie runter und rief schrill: „Er ist tot. Er wird nie wieder kommen. Und alles ist meine Schuld.“ Mit den Worten drehte sie sich rasch um und verschwand in der Hütte. Charies Blick wurde traurig. Das Mädchen trug die Last des Verlustes, verfolgt von anderen alten Dämonen. Charie tröstete Buck, dem auf die Nachricht vom Tod des Heilers, dicke Tränen über die Wangen kullerten. Aera beobachtet aus dem Haus heraus die liebevolle Geste und beschloss ihr Misstrauen so gut es ging, zu verdrängen. „Vielleicht hat Vater die ganze Zeit auf Besucher, wie diese gehofft, anstatt auf meine Hilfe.“ Aber sie würde sich beweisen. Sie würde sich Franzibian als würdige erweisen. Eilig suchte sie alle greifbaren Heilmittel zusammen und trat wieder ins Freie. „Ich helfe Euch“, nickte sie der Elfe zu. „Und ihr helft uns!“ Die Bestimmtheit in den Worten Aeras ließ Charie aufhorchen. Die beiden gingen Seite an Seite in Richtung Brunnen. Buck trottete leise schniefend hinterher.
 So liefen die drei anfangs schweigend nebeneinander zurück Richtung Brunnen. Charie brach die Stille mit einer für sie unverfänglich erscheinenden Frage: „Aera, wo sind die anderen Bewohner? Wir haben auf dem Weg ins Dorf niemanden gesehen.“ Aera überlegte kurz. „Der Tod geht um im Dorf seit drei Monden und hat viele Menschen aus dem Dorf getrieben. Alle gehen… alle.“, kam ihr schwer über de Lippen. Charie ärgerte sich kurz, dass sie die Frage nicht besser formuliert hatte. „Ich meine, es leben doch noch andere Menschen außer Dir in diesem Dorf.“ Bevor ihr Satz ganz zu Ende war, merkte sie erneut den Spielraum, der ungute Gefühle wecken konnte. „Ich meine…“, korrigierte sie und blieb in den Worten hängen. Es war nicht ihre Sprache. Die menschliche hatte so wenig Facetten und Feinheit. Aera half ihr zum Glück aus dem Dilemma. „Die meisten vom Dorf werden bei der Versammlung bei Dorfvorsteher Herr Nurbart sein, wenn ihr das meint. Aber ich hatte, um ehrlich zu sein, mir war nicht danach.“ Area wundert sich über ihre eigene Offenheit. Charie überging es geschickt. „Wenn ich richtig verstanden habe, kennst Du Dich gut in der Heilkunst aus. Wie ich erwähnte, wurde einer meiner Webegleiter von einem unnatürlich tollwütigen Stier mitten auf der Straße angegriffen. Glaubst Du, Du kannst seinen Arm heilen?“ Das junge Mädchen blickte auf und sah Charie von der Seite an. „Ich habe nie zuvor Zwerge gesehen. Auch keine Elfen wie Euch! Ich weiß nicht, ob ich da helfen kann. Vielleicht lässt er mich überhaupt nicht an sich heran?“ Von Charie erklang ein sanft klingendes Lacheln. „Oh – Zwerge sind zwar ewig am nörgeln und haben einen immensen Dickschädel, aber so sehr unterscheiden sie sich nicht von Menschen. Alles ist kleiner oder dicker, die Proportionen sind recht gestaucht und manchmal frage ich mich, wo sie keine Haare haben, aber sonst Atmen, Essen und verrichten sie ihre Notdurft, wie andere auch.“ Buck ergänze von hinten: „Die beiden sind wie kleine Kinder. Aber alt wie Großvater Worntahl. Und sie lassen Dich bestimmt helfen, denn wer vor Stier stehen bleibt, braucht Hilfe!“ „Ja Buck, wahrhaftig. So jemand brauch dringend Hilfe!“ Charie lachte erneut leise. Aera fand es irgendwie ansteckend. Dann begriff sie die Anspielung der Elfe und prustet laut los. „Der Zwerg ist echt nicht ausgewichen?“ „Nein – keinen Fingerbreit!“, erwiderte Charie. „Sehr zum Leidwesen des Stiers“, ergänzte sie genüsslich Lächelnd. „Seltsam aber, warum der Bulle extrem aggressiv war. Wir hatten ihn unmöglich gereizt. Zudem war seine Zunge merkwürdig verfärbt. Es wirkte, als wäre er vergiftet worden und hatte schlimme Schmerzen gelitten.“ Charie warf Aera einen direkten, fragenden Blick zu. Aera drehte rasch den Kopf und senkte ihren Blick. „Der Fluch holt Mensch wie Tier. Franzibian hat beobachtet, wie die Tiere vorher verrückt zu werden scheinen. Wütend, aggressiv, manche haben sich selbst verletzt.“ „Fluch?“ wiederholte Charie das Wort leise. Buck hatte diesen Ausdruck gleichfalls gebraucht.“ Aera ballte ihre Fäuste. „Es ist das Wasser aus dem Boden. Es ist giftig geworden. Ohne Vorwarnung. Lebewesen, die es trinken, gehen daran in wenigen Tagen zugrunde. Manche zeigen die ersten Symptome und sind einen Tag später tot, andere leiden Tage, ohne dass ich – wir - irgendjemand dagegen etwas tun kann.“ Ihre Stimme vibrierte vor Zorn und Trauer.“ Die Elfe schwieg und verarbeitet das Gehörte in ihren Gedanken. Die Menschen kannten die Ursache, konnten sie jedoch nicht unterbinden. „Du sagt, das Wasser ist giftig. Was trinkt ihr dann?“ erkundigte sich Charie. Aera nickte: „Das Wasser und die Tiere, die es trinken und dann die Menschen, die es trinken und die das Vieh essen. Aber was mein Vater zur Verzweiflung trieb, es war nie Gift zu finden. Wasser, Tiere, Menschen. Sie alle zeigten die Erscheinung, die Auswirkung, aber da war nichts. Franzibian war davon überzeugt, dass alles eine normale Ursache hatte. Aber ich glaube nicht mehr daran. Es ist wie ein ‚Fluch‘, der über uns hereingebrochen ist!“ Buck brummte vor sich hin: „Wie Fluch, wie Edda singt von bösen Worten von bösen Wesen.“ Aera erschauderte. Ihr stand das Grauen im Gesicht. Während sie weiter liefen, erzählte die Tochter des Heilers über die verzweifelte Suche nach Spuren, ihren Untersuchungen und Versuchen, die alle keinen Ausweg zeigten. Bis am Ende Franzibian selbst diesem Bösen erlag.“ Aeras Lippen waren schmal, blass und sie zitterte. Bevor Charie auf sie eingehen konnte, jagte der Donnerknall durch das Dorf. Charie rannte ohne zu zögern los, Aera folgte ihr so gut es ging. Buck kauerte sich auf den Boden, schütze seinen Kopf und wimmerte.
So liefen die drei anfangs schweigend nebeneinander zurück Richtung Brunnen. Charie brach die Stille mit einer für sie unverfänglich erscheinenden Frage: „Aera, wo sind die anderen Bewohner? Wir haben auf dem Weg ins Dorf niemanden gesehen.“ Aera überlegte kurz. „Der Tod geht um im Dorf seit drei Monden und hat viele Menschen aus dem Dorf getrieben. Alle gehen… alle.“, kam ihr schwer über de Lippen. Charie ärgerte sich kurz, dass sie die Frage nicht besser formuliert hatte. „Ich meine, es leben doch noch andere Menschen außer Dir in diesem Dorf.“ Bevor ihr Satz ganz zu Ende war, merkte sie erneut den Spielraum, der ungute Gefühle wecken konnte. „Ich meine…“, korrigierte sie und blieb in den Worten hängen. Es war nicht ihre Sprache. Die menschliche hatte so wenig Facetten und Feinheit. Aera half ihr zum Glück aus dem Dilemma. „Die meisten vom Dorf werden bei der Versammlung bei Dorfvorsteher Herr Nurbart sein, wenn ihr das meint. Aber ich hatte, um ehrlich zu sein, mir war nicht danach.“ Area wundert sich über ihre eigene Offenheit. Charie überging es geschickt. „Wenn ich richtig verstanden habe, kennst Du Dich gut in der Heilkunst aus. Wie ich erwähnte, wurde einer meiner Webegleiter von einem unnatürlich tollwütigen Stier mitten auf der Straße angegriffen. Glaubst Du, Du kannst seinen Arm heilen?“ Das junge Mädchen blickte auf und sah Charie von der Seite an. „Ich habe nie zuvor Zwerge gesehen. Auch keine Elfen wie Euch! Ich weiß nicht, ob ich da helfen kann. Vielleicht lässt er mich überhaupt nicht an sich heran?“ Von Charie erklang ein sanft klingendes Lacheln. „Oh – Zwerge sind zwar ewig am nörgeln und haben einen immensen Dickschädel, aber so sehr unterscheiden sie sich nicht von Menschen. Alles ist kleiner oder dicker, die Proportionen sind recht gestaucht und manchmal frage ich mich, wo sie keine Haare haben, aber sonst Atmen, Essen und verrichten sie ihre Notdurft, wie andere auch.“ Buck ergänze von hinten: „Die beiden sind wie kleine Kinder. Aber alt wie Großvater Worntahl. Und sie lassen Dich bestimmt helfen, denn wer vor Stier stehen bleibt, braucht Hilfe!“ „Ja Buck, wahrhaftig. So jemand brauch dringend Hilfe!“ Charie lachte erneut leise. Aera fand es irgendwie ansteckend. Dann begriff sie die Anspielung der Elfe und prustet laut los. „Der Zwerg ist echt nicht ausgewichen?“ „Nein – keinen Fingerbreit!“, erwiderte Charie. „Sehr zum Leidwesen des Stiers“, ergänzte sie genüsslich Lächelnd. „Seltsam aber, warum der Bulle extrem aggressiv war. Wir hatten ihn unmöglich gereizt. Zudem war seine Zunge merkwürdig verfärbt. Es wirkte, als wäre er vergiftet worden und hatte schlimme Schmerzen gelitten.“ Charie warf Aera einen direkten, fragenden Blick zu. Aera drehte rasch den Kopf und senkte ihren Blick. „Der Fluch holt Mensch wie Tier. Franzibian hat beobachtet, wie die Tiere vorher verrückt zu werden scheinen. Wütend, aggressiv, manche haben sich selbst verletzt.“ „Fluch?“ wiederholte Charie das Wort leise. Buck hatte diesen Ausdruck gleichfalls gebraucht.“ Aera ballte ihre Fäuste. „Es ist das Wasser aus dem Boden. Es ist giftig geworden. Ohne Vorwarnung. Lebewesen, die es trinken, gehen daran in wenigen Tagen zugrunde. Manche zeigen die ersten Symptome und sind einen Tag später tot, andere leiden Tage, ohne dass ich – wir - irgendjemand dagegen etwas tun kann.“ Ihre Stimme vibrierte vor Zorn und Trauer.“ Die Elfe schwieg und verarbeitet das Gehörte in ihren Gedanken. Die Menschen kannten die Ursache, konnten sie jedoch nicht unterbinden. „Du sagt, das Wasser ist giftig. Was trinkt ihr dann?“ erkundigte sich Charie. Aera nickte: „Das Wasser und die Tiere, die es trinken und dann die Menschen, die es trinken und die das Vieh essen. Aber was mein Vater zur Verzweiflung trieb, es war nie Gift zu finden. Wasser, Tiere, Menschen. Sie alle zeigten die Erscheinung, die Auswirkung, aber da war nichts. Franzibian war davon überzeugt, dass alles eine normale Ursache hatte. Aber ich glaube nicht mehr daran. Es ist wie ein ‚Fluch‘, der über uns hereingebrochen ist!“ Buck brummte vor sich hin: „Wie Fluch, wie Edda singt von bösen Worten von bösen Wesen.“ Aera erschauderte. Ihr stand das Grauen im Gesicht. Während sie weiter liefen, erzählte die Tochter des Heilers über die verzweifelte Suche nach Spuren, ihren Untersuchungen und Versuchen, die alle keinen Ausweg zeigten. Bis am Ende Franzibian selbst diesem Bösen erlag.“ Aeras Lippen waren schmal, blass und sie zitterte. Bevor Charie auf sie eingehen konnte, jagte der Donnerknall durch das Dorf. Charie rannte ohne zu zögern los, Aera folgte ihr so gut es ging. Buck kauerte sich auf den Boden, schütze seinen Kopf und wimmerte.
 22.Eintrag
22.Eintrag
 Langsam regten sich die Körper wieder. Zenia und Leomar untersuchten die Gestalten. Keiner schien lebensbedrohlichen Schaden genommen zu haben. Leomar ging in Gedanken noch einmal die Bilder durch, die sich vor wenigen Augenblicken abgespielt hatten. Sein Blick hatte grade noch auf dem niedergeschlagenen Zwerg geruht, als er Zenias erstaunten Ausruf vernommen hatte. Sie war ihm vielleicht zwanzig oder dreißig Schritte vorausgewesen. Vor einer leicht schiefen Holzhütte hatten Elfen, Zwerge, Menschen und sogar ein weißes Tier miteinander gekämpft. Keinen Wimpernschlag später hatte aus heiterem Himmel ein Blitz mitten in die Gruppe eingeschlagen und alle, die nicht bereits am Boden lagen, weggeschleudert. Als Leomar sich von dem blendenden Licht erholt gehabt hatte und die wenigen Sterne vor seinen Augen wieder eine klarere Sicht ermöglicht hatten, waren alle Gestalten regungslos am Boden gelegen. Zorkana hatte geflucht und ihre Ausdrücke bezeugten langjährige Übung. Danach hatte sie ihn gerufen und aufgefordert, sich zusammen um die Verletzten zu kümmern. Mittlerweile saßen die meisten der bunten Runde benommen, dafür einträchtig und friedlich nebeneinander und versuchten ihre Koordination von Gliedmaßen und Gedanken zu ordnen. Es gab Leomar ausreichend Zeit Seylina, Najiba und Brandur zu mustern. Irgendwie passte der Zwerg vor Nurbarts Haus ganz gut dazu. Wirklich verletzt war niemand. Die Frau in heller Lederkleidung hatte ein paar frische Kratzer am Arm und im Gesicht, die von Krallen stammen mochten. Die Eflin war unverletzt und versuchte sich trotz eindeutiger Desorientierung einen Überblick zu verschaffen. Scheinbar suchte sie etwas. Den Zwerg hatte es am schlimmsten erwischt. Er hielt seinen schiefen Arm, der bereits vorher gebrochen gewesen sein musste, an seinen Körper gepresst. Obwohl kein Laut des Schmerzes über seinen Lippen kam, offenbarten seine Gesichtszüge Gegenteiliges. Um absolute Gewissheit zu haben, untersuchte sich Leomar selbst. Keine Verwirrung, kein Zittern, kein Brandgeruch, kein Leuchten, kein körperliches Signal einer Verletzung. Er war gesund. War das wirklich ein Blitz der vom Himmel gefahren war? Der Boden zeigte keine Brandspuren, noch war eine andere Einschlagstelle zu entdecken. Ein göttliches Wunder, weil fremde Rassen sich nicht gegenseitig an die Kehle gehen sollten? Leomar wischte diese Theorie zur Seite. Vieler dieser Rassen glaubten nicht einmal an die Götter der Menschen. Also ein magischer Angriff! Allerding war dem weit gereisten und gebildeten Magier, kein Zauber bekannt, der eine entsprechende Wirkung hervorrufen würde. Elfische Magie kam in Betracht. Diese war wenig erforscht. Diese Lösung hatte ebenfalls einen Haken: Wer würde sich selbst zum Ziel solch eines Angriffs wählen. Unter Anbetracht der Sackgasse logischen Denkens, wirkte Leomar einen Zauber. Seine Hände bewegten sich einem festen Muster folgend über das Gebiet des Einschlags, seine Lippen formten magische, unverständliche Worte. Geste und Wort verbanden sich, suchten arkane Ströme der Macht. Leomars Geist suchte und formte, bis sich ihm Muster, Spinnweben gleich, auf dem Boden offenbarten. Leomars Augen weiteten sich vor Erstaunen. Bei den Göttern, das waren Reste eines Spruches. Aber was für eines magischen Wirkens? Die Muster waren komplexer als jeder ihm Bekannter. Er konnte nicht einen einzigen Anhaltspunkt erkennen, auf welche Art der Magie dieses Muster verwies. Die harschen Worte von Zenia rissen ihn aus seiner Konzentration: „Wollt ihr da Wurzeln schlagen? Die Frau! Ihr erinnert Euch? Da drinnen liegt jemand im Sterben!“
Langsam regten sich die Körper wieder. Zenia und Leomar untersuchten die Gestalten. Keiner schien lebensbedrohlichen Schaden genommen zu haben. Leomar ging in Gedanken noch einmal die Bilder durch, die sich vor wenigen Augenblicken abgespielt hatten. Sein Blick hatte grade noch auf dem niedergeschlagenen Zwerg geruht, als er Zenias erstaunten Ausruf vernommen hatte. Sie war ihm vielleicht zwanzig oder dreißig Schritte vorausgewesen. Vor einer leicht schiefen Holzhütte hatten Elfen, Zwerge, Menschen und sogar ein weißes Tier miteinander gekämpft. Keinen Wimpernschlag später hatte aus heiterem Himmel ein Blitz mitten in die Gruppe eingeschlagen und alle, die nicht bereits am Boden lagen, weggeschleudert. Als Leomar sich von dem blendenden Licht erholt gehabt hatte und die wenigen Sterne vor seinen Augen wieder eine klarere Sicht ermöglicht hatten, waren alle Gestalten regungslos am Boden gelegen. Zorkana hatte geflucht und ihre Ausdrücke bezeugten langjährige Übung. Danach hatte sie ihn gerufen und aufgefordert, sich zusammen um die Verletzten zu kümmern. Mittlerweile saßen die meisten der bunten Runde benommen, dafür einträchtig und friedlich nebeneinander und versuchten ihre Koordination von Gliedmaßen und Gedanken zu ordnen. Es gab Leomar ausreichend Zeit Seylina, Najiba und Brandur zu mustern. Irgendwie passte der Zwerg vor Nurbarts Haus ganz gut dazu. Wirklich verletzt war niemand. Die Frau in heller Lederkleidung hatte ein paar frische Kratzer am Arm und im Gesicht, die von Krallen stammen mochten. Die Eflin war unverletzt und versuchte sich trotz eindeutiger Desorientierung einen Überblick zu verschaffen. Scheinbar suchte sie etwas. Den Zwerg hatte es am schlimmsten erwischt. Er hielt seinen schiefen Arm, der bereits vorher gebrochen gewesen sein musste, an seinen Körper gepresst. Obwohl kein Laut des Schmerzes über seinen Lippen kam, offenbarten seine Gesichtszüge Gegenteiliges. Um absolute Gewissheit zu haben, untersuchte sich Leomar selbst. Keine Verwirrung, kein Zittern, kein Brandgeruch, kein Leuchten, kein körperliches Signal einer Verletzung. Er war gesund. War das wirklich ein Blitz der vom Himmel gefahren war? Der Boden zeigte keine Brandspuren, noch war eine andere Einschlagstelle zu entdecken. Ein göttliches Wunder, weil fremde Rassen sich nicht gegenseitig an die Kehle gehen sollten? Leomar wischte diese Theorie zur Seite. Vieler dieser Rassen glaubten nicht einmal an die Götter der Menschen. Also ein magischer Angriff! Allerding war dem weit gereisten und gebildeten Magier, kein Zauber bekannt, der eine entsprechende Wirkung hervorrufen würde. Elfische Magie kam in Betracht. Diese war wenig erforscht. Diese Lösung hatte ebenfalls einen Haken: Wer würde sich selbst zum Ziel solch eines Angriffs wählen. Unter Anbetracht der Sackgasse logischen Denkens, wirkte Leomar einen Zauber. Seine Hände bewegten sich einem festen Muster folgend über das Gebiet des Einschlags, seine Lippen formten magische, unverständliche Worte. Geste und Wort verbanden sich, suchten arkane Ströme der Macht. Leomars Geist suchte und formte, bis sich ihm Muster, Spinnweben gleich, auf dem Boden offenbarten. Leomars Augen weiteten sich vor Erstaunen. Bei den Göttern, das waren Reste eines Spruches. Aber was für eines magischen Wirkens? Die Muster waren komplexer als jeder ihm Bekannter. Er konnte nicht einen einzigen Anhaltspunkt erkennen, auf welche Art der Magie dieses Muster verwies. Die harschen Worte von Zenia rissen ihn aus seiner Konzentration: „Wollt ihr da Wurzeln schlagen? Die Frau! Ihr erinnert Euch? Da drinnen liegt jemand im Sterben!“
 Diesen Ruf vernahm Charie und Aera gleichermaßen. Sie sahen Zenia und Leomar in der Hütte verschwinden, während die anderen davor, nach wie vor benommen, sich gegenseitig beim Aufstehen halfen. Seylina schauten sich nach dem weißen Wolf um. Vergebens. Brandur hielt sich mit einer Hand den Schädel und meinte, ihm wäre, als ob ein Blitz in seinen Helm gefahren wäre. Najiba verzog die Wange und spürte das Brennen beim Bewegen der Muskeln. Eine harmlose Wunde im Vergleich zu dem, was ihr hätte wiederfahren können.
Diesen Ruf vernahm Charie und Aera gleichermaßen. Sie sahen Zenia und Leomar in der Hütte verschwinden, während die anderen davor, nach wie vor benommen, sich gegenseitig beim Aufstehen halfen. Seylina schauten sich nach dem weißen Wolf um. Vergebens. Brandur hielt sich mit einer Hand den Schädel und meinte, ihm wäre, als ob ein Blitz in seinen Helm gefahren wäre. Najiba verzog die Wange und spürte das Brennen beim Bewegen der Muskeln. Eine harmlose Wunde im Vergleich zu dem, was ihr hätte wiederfahren können.
 Seylina stand als Erste wieder sicher auf den Beinen. Ihre Haut kribbelte. Sie wusste beim besten Willen nicht, was passiert war. Eben noch war ein weißer Wolf im Begriff sie anzugreifen, dann war sie geblendet worden und hatte auf dem Boden gelegen. Der Wolf war weg. "Ein Blitz? Der Wolf verschwunden? Das konnte kein Zufall sein.", dachte Seylina.
„Eindeutig war hier Magie am Werk. Vielleicht ein Teleportationszauber?“ Sie hatte von solcher Magie gehört, jedoch nie dessen Wirkung gesehen. Ein echter Blitz, hätte sie alle getötet, zumindest dessen war sie sich gewiss. Oder war das Tier nicht real gewesen? Nur in ihrem Geist existent. Das Pferd hatte das Raubtier ignoriert. Der schwarze Hengst stand nach wie vor grasend, ein wenig näher an der Hütte und zeigte selbst nach dem Blitz nicht den Hauch von Aufregung. Hier war mächtige Magie am Werk gewesen. Seylina schüttelt unmerklich ihren Kopf und sortierte Gedanken. Der Mann in der Robe, der nach dem Vorfall aufgetaucht war, hatte gleichfalls arkane Kräfte wallten lassen. Es war unschwer an den Bewegungen seiner Hände und dem typischen Gemurmel erkennbar gewesen. Was hatte er gezaubert oder entdeckt? Das Wort „Notfall“ drängt sich in ihr Bewusstsein. Notfall? Richtig! In der kleinen, schiefen Holzhütte. Seylina würde später über die Geschehnisse mit ihren Weggefährten reden und begab sich zur offen stehenden Tür der Hütte. Nicht ohne misstrauisch die Augen nach einem weißen Tier offen zu halten. Noch bevor die Elfin das kleine Gebäude betreten konnte, trat Zorkana nach draußen, nickte ihr zu und rief, während sie an ihr vorbeiging. „Werter Leomar, ihr bekommt Unterstützung. Zu dritt ist es zu eng und elfisches Wissen bringt uns vielleicht weiter. An Wundversorgung habe ich getan, was getan werden konnte.“ Seylina betrat das Haus.
Seylina stand als Erste wieder sicher auf den Beinen. Ihre Haut kribbelte. Sie wusste beim besten Willen nicht, was passiert war. Eben noch war ein weißer Wolf im Begriff sie anzugreifen, dann war sie geblendet worden und hatte auf dem Boden gelegen. Der Wolf war weg. "Ein Blitz? Der Wolf verschwunden? Das konnte kein Zufall sein.", dachte Seylina.
„Eindeutig war hier Magie am Werk. Vielleicht ein Teleportationszauber?“ Sie hatte von solcher Magie gehört, jedoch nie dessen Wirkung gesehen. Ein echter Blitz, hätte sie alle getötet, zumindest dessen war sie sich gewiss. Oder war das Tier nicht real gewesen? Nur in ihrem Geist existent. Das Pferd hatte das Raubtier ignoriert. Der schwarze Hengst stand nach wie vor grasend, ein wenig näher an der Hütte und zeigte selbst nach dem Blitz nicht den Hauch von Aufregung. Hier war mächtige Magie am Werk gewesen. Seylina schüttelt unmerklich ihren Kopf und sortierte Gedanken. Der Mann in der Robe, der nach dem Vorfall aufgetaucht war, hatte gleichfalls arkane Kräfte wallten lassen. Es war unschwer an den Bewegungen seiner Hände und dem typischen Gemurmel erkennbar gewesen. Was hatte er gezaubert oder entdeckt? Das Wort „Notfall“ drängt sich in ihr Bewusstsein. Notfall? Richtig! In der kleinen, schiefen Holzhütte. Seylina würde später über die Geschehnisse mit ihren Weggefährten reden und begab sich zur offen stehenden Tür der Hütte. Nicht ohne misstrauisch die Augen nach einem weißen Tier offen zu halten. Noch bevor die Elfin das kleine Gebäude betreten konnte, trat Zorkana nach draußen, nickte ihr zu und rief, während sie an ihr vorbeiging. „Werter Leomar, ihr bekommt Unterstützung. Zu dritt ist es zu eng und elfisches Wissen bringt uns vielleicht weiter. An Wundversorgung habe ich getan, was getan werden konnte.“ Seylina betrat das Haus.
 Charie staunte über das Durcheinander auf dem Platz. Plötzlich gab es so viele Leute. „Aera, vielleicht solltest Du Dich erstmal um diese Frau kümmern, wenn es so schlecht um sie steht. Ich schau nach meinen Gefährten. Brandurs Arm kann warten.“ schlug sie vor. Aera stockte im Laufen. Charie blieb stehen und hielt Aera an der Schulter. Das Mädchen zuckte unter der Berührung zusammen. Die Elfin behielt den Körperkontakt. Ihre Hand lag leicht wie eine Feder auf der Kleinen, dennoch wirkte Aera, als ob ein Zentner ihren Körper in den Boden drückte. Was hatte das Kind? Aera krauste die Nase, sammelte ihren Mut und blickte Charie direkt in die Augen. Charie sah die bernsteinfarbene Iris, wie sie leuchtete, wirbelte und mit einem Mal sah sie Bilder aus der Vergangenheit. Nicht ihrer Geschichte. Wie in einem Traum, Bilder, bewegte Bilder, Szenen und sie fühlte. Sie spürte. Nicht ihre Gefühle. So fremdartig, intensiv menschliche Gefühle. Was passierte mit ihr. Einmal, als sie in diese Glaskugel eines Gauklers geblickt hatte, hatte dieser ihr auf solche Weise seine Geschichte gezeigt. Dieser merkwürdige Gaukler. Ihm verdankte sie offenbar diese extreme Sensibilität Lebendem gegenüber, die über das elfische hinausging. Aeras Stimme riss sie aus der Trance: „Vater hat immer gesagt, es sei unhöflich, andere Wesen anzustarren!“ Als Charie nicht reagierte, sprach sie weiter: „In das Haus gehe ich nicht. Ich habe in letzter Zeit zu oft einen vertrauten Menschen in seinem Blut und Erbrochenen gesehen und hilflos seinem Todeskampf beigewohnt. Nein. Ich kümmere ich mich da um den Zwerg!“ Sie lief los. Charie, leicht überrumpelt, änderte ihren Plan. Sie rief Aera hinterher: „Darf ich mich in Eurem Kräutergarten umsehen?“ „Nehmt was Ihr brauchen könnt!“ Die Elfin blickte Aera hinterher. Sollte sie das Mädchen auf ihre Geschichte ansprechen. Dieser Gaukler! War diese Gabe, die er in ihr Geweckt hatte, ein Segen oder ein Fluch. So stark, fast unheimlich, wie eben, war es bisher nie gewesen. Gaukler? Dieser Tao Pan, war alles andere als ein normaler Gaukler gewesen. Tief in Gedanken bewegte sie sich erneut zurück zum Haus des Heilers. Der Garten war professionell sortiert, hervorragend gepflegt, bis auf wenige Wildpflanzen, die an unpassenden Stellen sich ein neues Reich eroberten. Charie fand schnell, was sie brauchte. Ihr Wissen über Heil- und Nutzpflanzen hatte sie auf ihren langen Reisen bei den Menschen immer weiter ausbauen können. Trotzdem entdeckte sie in dem Kräuterbestand viele Gewächse, die ihr fremd waren. Ein müdes Schnaufen ließ sie herumschnellen. Auf den kleinen Zaun gestützt, mit unverwechselbar deprimierten Gesichtsausdruck, zeigte Boradin auf das Bündel Blätter in Charies Hand: „Us bou dom Gomuse was gogon Brummschadol und gschwollonon Kuofor?“ Seine andere Hand hielt er vorsichtig gegen sein Kinn. Selbst bei seiner imposanten Bartpracht, war die rote Schwellung erkennbar. „Was ist Euch wiederfahren?“ erkundigte sich Charie überrascht. Der Zwerg winkte ab: „Much hat ouno Vorruckte auf dom falschon Fuss orwuscht.“
Charie staunte über das Durcheinander auf dem Platz. Plötzlich gab es so viele Leute. „Aera, vielleicht solltest Du Dich erstmal um diese Frau kümmern, wenn es so schlecht um sie steht. Ich schau nach meinen Gefährten. Brandurs Arm kann warten.“ schlug sie vor. Aera stockte im Laufen. Charie blieb stehen und hielt Aera an der Schulter. Das Mädchen zuckte unter der Berührung zusammen. Die Elfin behielt den Körperkontakt. Ihre Hand lag leicht wie eine Feder auf der Kleinen, dennoch wirkte Aera, als ob ein Zentner ihren Körper in den Boden drückte. Was hatte das Kind? Aera krauste die Nase, sammelte ihren Mut und blickte Charie direkt in die Augen. Charie sah die bernsteinfarbene Iris, wie sie leuchtete, wirbelte und mit einem Mal sah sie Bilder aus der Vergangenheit. Nicht ihrer Geschichte. Wie in einem Traum, Bilder, bewegte Bilder, Szenen und sie fühlte. Sie spürte. Nicht ihre Gefühle. So fremdartig, intensiv menschliche Gefühle. Was passierte mit ihr. Einmal, als sie in diese Glaskugel eines Gauklers geblickt hatte, hatte dieser ihr auf solche Weise seine Geschichte gezeigt. Dieser merkwürdige Gaukler. Ihm verdankte sie offenbar diese extreme Sensibilität Lebendem gegenüber, die über das elfische hinausging. Aeras Stimme riss sie aus der Trance: „Vater hat immer gesagt, es sei unhöflich, andere Wesen anzustarren!“ Als Charie nicht reagierte, sprach sie weiter: „In das Haus gehe ich nicht. Ich habe in letzter Zeit zu oft einen vertrauten Menschen in seinem Blut und Erbrochenen gesehen und hilflos seinem Todeskampf beigewohnt. Nein. Ich kümmere ich mich da um den Zwerg!“ Sie lief los. Charie, leicht überrumpelt, änderte ihren Plan. Sie rief Aera hinterher: „Darf ich mich in Eurem Kräutergarten umsehen?“ „Nehmt was Ihr brauchen könnt!“ Die Elfin blickte Aera hinterher. Sollte sie das Mädchen auf ihre Geschichte ansprechen. Dieser Gaukler! War diese Gabe, die er in ihr Geweckt hatte, ein Segen oder ein Fluch. So stark, fast unheimlich, wie eben, war es bisher nie gewesen. Gaukler? Dieser Tao Pan, war alles andere als ein normaler Gaukler gewesen. Tief in Gedanken bewegte sie sich erneut zurück zum Haus des Heilers. Der Garten war professionell sortiert, hervorragend gepflegt, bis auf wenige Wildpflanzen, die an unpassenden Stellen sich ein neues Reich eroberten. Charie fand schnell, was sie brauchte. Ihr Wissen über Heil- und Nutzpflanzen hatte sie auf ihren langen Reisen bei den Menschen immer weiter ausbauen können. Trotzdem entdeckte sie in dem Kräuterbestand viele Gewächse, die ihr fremd waren. Ein müdes Schnaufen ließ sie herumschnellen. Auf den kleinen Zaun gestützt, mit unverwechselbar deprimierten Gesichtsausdruck, zeigte Boradin auf das Bündel Blätter in Charies Hand: „Us bou dom Gomuse was gogon Brummschadol und gschwollonon Kuofor?“ Seine andere Hand hielt er vorsichtig gegen sein Kinn. Selbst bei seiner imposanten Bartpracht, war die rote Schwellung erkennbar. „Was ist Euch wiederfahren?“ erkundigte sich Charie überrascht. Der Zwerg winkte ab: „Much hat ouno Vorruckte auf dom falschon Fuss orwuscht.“
 23.Eintrag
23.Eintrag
 In die kleine Hütte viel gedämpftes Licht. Der vordere Raum mit einem großen Tisch, zwei Hockern, einer schmalen Feuerstelle aus Stein mit ein paar Kochutensilien, einer Kommode, und einem schiefen Schrank, war karg eingerichtet. Keinerlei Schmuck oder Dekoration verschönerte die Holzbalken, keine Decken oder Tücher machten den Raum gemütlicher. Einige leere Bretter waren an de Wände befestigt. Darauf lagen übliche Kleinigkeiten des Alltags. Es erinnerte an eine ehemalige Werkstatt. In der hinteren Ecke, auf einer aufgeräumten Liegestätte am Boden, lagen ein schwerer Rucksack, zwei Satteltaschen, ein blitzendes leicht gekrümmtes Schwert aus bläulichem Stahl und eine gerollte, feine Wolldecke. Durch einen schmalen Durchlass gelangte man in einen zweiten Raum. Er stand im krassen Gegensatz zu dem größeren vorderen Bereich. Die schweren Balken waren von dunkelgrünen Tuchstoffen verhängt. Drei kleine Truhen an der hinteren Wand, ebenfalls mit Tuch gelbgrünen bedeckt, dienten als Ablage einer Vielzahl an Instrumenten. Ein schmales Wandregal enthielt eine ansehnliche Sammlung an Schnitzereien und kleinen, bunten Natursteinen. Linker Hand stand ein gezimmertes Bett mit Kopf und Fußende, verziert mit allerlei Blumen und Tiergestalten. Zwei dicke, flauschige Kissen lagen am Boden, um der Person im Bett mehr Platz zu verschaffen. Edda, in ein dünnes Schlafgewand gekleidet, war bleich, fieberte stark und blutige Flecken überdeckten das grobe Tuch um ihren Kopf. Leomar stand vor der Frau mittleren Alters und betrachtete sie eindringlich, als Seylina hinzukam. Er bemerkte die Eflin überhaupt nicht. Immer wieder wurde Eddas Körper starr, verkrampfte unter Schmerzen, bis diese Erbarmen zeigten und die Muskulatur erschlaffen ließen. Gelegentlich drang ein schwaches, kaum vernehmliches Stöhnen aus ihrem Mund. Ihre Augen starrten ins Leere, trübe, glasig, weit entfernt. Es brauchte keine besondere Kenntnis der Heilkunde: Die Frau würde ohne Hilfe bald im Totenreich weilen. Der Blick des Magiers fiel auf eine verbundene Hand. Der Verband, recht teures Material, war ausgezeichnet angelegt. Jemand hatte mit nassen Tüchern versucht, das Fieber zu senken. Mit wenig Erfolg. Leomar begann den Körper der Frau aufs gründlichste zu untersuchen. Tierbisse, entzündete Hautstellen, Verfärbungen, alles konnte einen Hinweise geben. Seylina hielt sich im Hintergrund und beobachtete den Magus aufmerksam. Dieser prüfte die Augen, die Zunge, untersuchte Fingerspitzen und Zehen. Er wickelte sorgsam den Verband ab. Eine längliche Fleischwunde in der Handinnenfläche. Die Wunde war sauber, ordentlich gereinigt und der Geruch von Isiswurz verriet die Verwendung dieses Wundbrand vorbeugenden Gewächses. Neben der, wie Leomar anerkennen musste, erstklassigen Wundversorgung, war die Wunde zu frisch, um eine Erklärung für den Zustand der Frau zu geben. Die Analyse ließ wenig Spielraum. Leomar, mit dem Hintergrundwissen über die Problematik mit dem Wasser, schloss eindeutig auf eine Vergiftung. Edda krampfte erneut. „Ich könnte einen beruhigenden Zauber über die Frau legen!“, erklang Seylina Stimme in dem Raum. Leomar hielt kurz inne und drehte sich um. Da stand unglaublicher Weise eine Waldelfe direkt hinter ihm. Ein seltenes Exemplar der nordischen Stämme aus den tiefen Wäldern der Tanebula. Bezaubernd, magisch und extrem Interessant. „Ähm – ja – ein Zauber der Beruhigung sollte keinen Schaden anrichten. Ob er bei einer akuten Vergiftung hilft, wissen allein die Götter. Gestatten Adeptus Laureatus Gernot Leomar Galdifei zu Methumis.“ Seylina nickte knapp, schob den Magus sanft zu Seite und wob ihre elfische Magie um Edda. Die Krämpfe schwächten sich ab, der vorher flache, stoßweise Atem wurde länger und gleichmäßiger. „Erstaunlich! Hervorragende Arbeit!“, kommentierte Leomar. „Nun tretet beiseite und lasst mich einen vernünftigen Heilspruch wirken. Die Gifte in ihrem Köper müssen neutralisiert werden. Dazu muss man … Leomar erklärte Ausführung und Wirkung bis ins kleinste Detail. Er zog die notwendige Energie aus der Umgebung, bündelte sie mit Gesten und Worten, richtete seinen Fokus der Konzentration schließlich auf Eddas Körper, um jede Art von Gift unschädlich zu machen. Edda riss die Augen auf, schrie erbärmlich, bäumte sich als würden Knochen brechen und spuckte Blut. Seylina nahm Edda in die Arme und hielt sie fest, bis der Anfall vorüber war. „Das war nicht unbedingt der erwartete gehlehrte Effekt“. Seylina zeigte Leomar einen der Stofffetzen, mit dem sie das Blut aufgefangen hatte. Es war zäh, schleimig und hatte eine grünliche Färbung. „Zumindest kommt es heraus!“, meinte die Elfin. Leomar zog die buschigen Augenbrauen hoch. „Aber es geht ihr kaum besser. Wenn ich richtig vermute, dann …“, „ ...dann ist es ein Fluch?“ beendete Seylina. Leomar winkte ab: „So weit sind wir noch lange nicht. Unter Betrachtung der Umstände würde ich eine Manipulation durch magisches Wirken jedoch nicht von der Hand weisen.“ Seylina überlegte, wo der unterschied lag, während Leomar zu einem weiteren Zauber ansetzte. Er sollte ihn in die Lage versetzen, Magie zu erkennen. Wenn er funktionierte, würden er magische Objekte oder unter magischem Einfluss stehende Personen in einem leicht farbigen Licht leuchten sehen. Das Ergebnis war ebenfalls gänzlich anders als im Lehrbuch beschrieben. Aus Eddas gesamtem Leib sickerte ein dicker, grünlich leuchtender Nebel. Seylina, die gleiche Idee verfolgend wie der Magier, sprach aus, was Leomar dachte: „Seht ihr das auch? Das ist kein Gift! Das ist kein Fluch! Nur, was ist es? Welche Magie hält lange an, einem Wesen wie eine Krankheit den Tod zu bringen?“ Leomar ergänzte mit ernster Mine: „Und lässt sich an Wasser als Träger binden? Keinesfalls ein Zauber einer Akadmie.“ „Nein, das ist kein Zauber!“, antwortete Seylina mit fester Stimme. „Die Natur ist aus dem Gleichgewicht!“ Leomar, der gegen seine Gewohnheit wortkarg geworden war, wiedersprach zaghaft: „Wenn es kein Zauber ist, warum sehen wir die wirkende Magie?“ Seylina zuckte minimal mit den Schultern: „Eine gute Frage, werter Magus, eine sehr gute Frage!“ Edda war in einen unruhigen Schlaf gefallen. Zumindest den nächsten Tag würde sie überleben.
In die kleine Hütte viel gedämpftes Licht. Der vordere Raum mit einem großen Tisch, zwei Hockern, einer schmalen Feuerstelle aus Stein mit ein paar Kochutensilien, einer Kommode, und einem schiefen Schrank, war karg eingerichtet. Keinerlei Schmuck oder Dekoration verschönerte die Holzbalken, keine Decken oder Tücher machten den Raum gemütlicher. Einige leere Bretter waren an de Wände befestigt. Darauf lagen übliche Kleinigkeiten des Alltags. Es erinnerte an eine ehemalige Werkstatt. In der hinteren Ecke, auf einer aufgeräumten Liegestätte am Boden, lagen ein schwerer Rucksack, zwei Satteltaschen, ein blitzendes leicht gekrümmtes Schwert aus bläulichem Stahl und eine gerollte, feine Wolldecke. Durch einen schmalen Durchlass gelangte man in einen zweiten Raum. Er stand im krassen Gegensatz zu dem größeren vorderen Bereich. Die schweren Balken waren von dunkelgrünen Tuchstoffen verhängt. Drei kleine Truhen an der hinteren Wand, ebenfalls mit Tuch gelbgrünen bedeckt, dienten als Ablage einer Vielzahl an Instrumenten. Ein schmales Wandregal enthielt eine ansehnliche Sammlung an Schnitzereien und kleinen, bunten Natursteinen. Linker Hand stand ein gezimmertes Bett mit Kopf und Fußende, verziert mit allerlei Blumen und Tiergestalten. Zwei dicke, flauschige Kissen lagen am Boden, um der Person im Bett mehr Platz zu verschaffen. Edda, in ein dünnes Schlafgewand gekleidet, war bleich, fieberte stark und blutige Flecken überdeckten das grobe Tuch um ihren Kopf. Leomar stand vor der Frau mittleren Alters und betrachtete sie eindringlich, als Seylina hinzukam. Er bemerkte die Eflin überhaupt nicht. Immer wieder wurde Eddas Körper starr, verkrampfte unter Schmerzen, bis diese Erbarmen zeigten und die Muskulatur erschlaffen ließen. Gelegentlich drang ein schwaches, kaum vernehmliches Stöhnen aus ihrem Mund. Ihre Augen starrten ins Leere, trübe, glasig, weit entfernt. Es brauchte keine besondere Kenntnis der Heilkunde: Die Frau würde ohne Hilfe bald im Totenreich weilen. Der Blick des Magiers fiel auf eine verbundene Hand. Der Verband, recht teures Material, war ausgezeichnet angelegt. Jemand hatte mit nassen Tüchern versucht, das Fieber zu senken. Mit wenig Erfolg. Leomar begann den Körper der Frau aufs gründlichste zu untersuchen. Tierbisse, entzündete Hautstellen, Verfärbungen, alles konnte einen Hinweise geben. Seylina hielt sich im Hintergrund und beobachtete den Magus aufmerksam. Dieser prüfte die Augen, die Zunge, untersuchte Fingerspitzen und Zehen. Er wickelte sorgsam den Verband ab. Eine längliche Fleischwunde in der Handinnenfläche. Die Wunde war sauber, ordentlich gereinigt und der Geruch von Isiswurz verriet die Verwendung dieses Wundbrand vorbeugenden Gewächses. Neben der, wie Leomar anerkennen musste, erstklassigen Wundversorgung, war die Wunde zu frisch, um eine Erklärung für den Zustand der Frau zu geben. Die Analyse ließ wenig Spielraum. Leomar, mit dem Hintergrundwissen über die Problematik mit dem Wasser, schloss eindeutig auf eine Vergiftung. Edda krampfte erneut. „Ich könnte einen beruhigenden Zauber über die Frau legen!“, erklang Seylina Stimme in dem Raum. Leomar hielt kurz inne und drehte sich um. Da stand unglaublicher Weise eine Waldelfe direkt hinter ihm. Ein seltenes Exemplar der nordischen Stämme aus den tiefen Wäldern der Tanebula. Bezaubernd, magisch und extrem Interessant. „Ähm – ja – ein Zauber der Beruhigung sollte keinen Schaden anrichten. Ob er bei einer akuten Vergiftung hilft, wissen allein die Götter. Gestatten Adeptus Laureatus Gernot Leomar Galdifei zu Methumis.“ Seylina nickte knapp, schob den Magus sanft zu Seite und wob ihre elfische Magie um Edda. Die Krämpfe schwächten sich ab, der vorher flache, stoßweise Atem wurde länger und gleichmäßiger. „Erstaunlich! Hervorragende Arbeit!“, kommentierte Leomar. „Nun tretet beiseite und lasst mich einen vernünftigen Heilspruch wirken. Die Gifte in ihrem Köper müssen neutralisiert werden. Dazu muss man … Leomar erklärte Ausführung und Wirkung bis ins kleinste Detail. Er zog die notwendige Energie aus der Umgebung, bündelte sie mit Gesten und Worten, richtete seinen Fokus der Konzentration schließlich auf Eddas Körper, um jede Art von Gift unschädlich zu machen. Edda riss die Augen auf, schrie erbärmlich, bäumte sich als würden Knochen brechen und spuckte Blut. Seylina nahm Edda in die Arme und hielt sie fest, bis der Anfall vorüber war. „Das war nicht unbedingt der erwartete gehlehrte Effekt“. Seylina zeigte Leomar einen der Stofffetzen, mit dem sie das Blut aufgefangen hatte. Es war zäh, schleimig und hatte eine grünliche Färbung. „Zumindest kommt es heraus!“, meinte die Elfin. Leomar zog die buschigen Augenbrauen hoch. „Aber es geht ihr kaum besser. Wenn ich richtig vermute, dann …“, „ ...dann ist es ein Fluch?“ beendete Seylina. Leomar winkte ab: „So weit sind wir noch lange nicht. Unter Betrachtung der Umstände würde ich eine Manipulation durch magisches Wirken jedoch nicht von der Hand weisen.“ Seylina überlegte, wo der unterschied lag, während Leomar zu einem weiteren Zauber ansetzte. Er sollte ihn in die Lage versetzen, Magie zu erkennen. Wenn er funktionierte, würden er magische Objekte oder unter magischem Einfluss stehende Personen in einem leicht farbigen Licht leuchten sehen. Das Ergebnis war ebenfalls gänzlich anders als im Lehrbuch beschrieben. Aus Eddas gesamtem Leib sickerte ein dicker, grünlich leuchtender Nebel. Seylina, die gleiche Idee verfolgend wie der Magier, sprach aus, was Leomar dachte: „Seht ihr das auch? Das ist kein Gift! Das ist kein Fluch! Nur, was ist es? Welche Magie hält lange an, einem Wesen wie eine Krankheit den Tod zu bringen?“ Leomar ergänzte mit ernster Mine: „Und lässt sich an Wasser als Träger binden? Keinesfalls ein Zauber einer Akadmie.“ „Nein, das ist kein Zauber!“, antwortete Seylina mit fester Stimme. „Die Natur ist aus dem Gleichgewicht!“ Leomar, der gegen seine Gewohnheit wortkarg geworden war, wiedersprach zaghaft: „Wenn es kein Zauber ist, warum sehen wir die wirkende Magie?“ Seylina zuckte minimal mit den Schultern: „Eine gute Frage, werter Magus, eine sehr gute Frage!“ Edda war in einen unruhigen Schlaf gefallen. Zumindest den nächsten Tag würde sie überleben.
 Brandur saß nach wie vor auf dem Hosenboden und kontrollierte seine Ausrüstung. Alles war da, nichts beschädigt. Keine weiteren Verwundungen. Dafür schmerzte sein Arm wie ein glühendes Eisen in der Hand. Was für ein hinterhältiger Angriff! Niemand, dem man sich entgegenstellen konnte. Solch „Hokuspokus“ war keine anständige Art des Kampfes. Äußerst vorsichtig bewegte Brandur den gebrochenen Arm. Das war ein Fehler der übelsten Sorte. Er gab es ungern zu, aber der Arm war unbrauchbar. Damit würde er keine Goldmünze vom Boden aufheben, geschweige denn einen Humpen Bier heben. Ein Bier! Ein kühles, großes, würziges, schaumiges Bier! Der Zwerg verzog das Gesicht. Aera wollte beim Anblick des schmerzverzerrten Ausdrucks von Brandur direkt losstürmen, zügelte sich aber und dachte an die Worte ihres Vaters: "Zuviel Misstrauen ist immer ein Unglück. Denke also daran - begegnest Du zu großem Misstrauen ist allzu große Vertrautheit schädlich.“ Sie hatte seine Ratschläge häufig nicht verstanden. In diesem Moment erkannte sie, welche Lektion er ihr an jenem Tag beigebracht hatte. Des Zwergen Augen schauten unter den buschigen, schwarzen Augenbrauen misstrauisch in die Umgebung, da war direkte, übermäßige Hilfe nicht angebracht. Fieberhaft dachte Aera nach und als ob die Ratschläge aus Vaters Kräuterbeutel kämen, presste sie diesen vor die Brust. Was hatte sie von Zwergen gehört. „Ach Vater, wie gut dass ich zu Edda ins Gasthaus gehen durfte. Die Geschichten über die Zwerge, nie hätte ich gedacht, dass sie mir helfen könnten.“ Aera lief näher an die Gruppe und richtete ihr Wort direkt an den Brandur: „Herr Zwerg, ich benötige dringend Hilfe mit der Bestimmung eines leuchtenden grünen Edelsteins. Da ich aber kein Geld habe, biete ich einen Handel an: Wie ich sehen muss sind Sie verwundet. Da der Kräuterkundige … da er ... also ...“, Aera räusperte sich, „ich kann den Knochen im Arm richten und auch die Haut darüber versorgen. Helfen wir uns gegenseitig?“ Brandurs Augen wurden groß. Seine dicke Nase kräuselte. Die Überraschung war unverkennbar. Da stand ein junges Menschenmädchen, aus Sicht eines Zwerges kaum alt genug, um sich allein versorgen zu können. Sie kannte sie seinen Namen. Sie wusste von seinem Arm. Sie wollte, dass er sich einen Edelstein anschaute! Wenigstens fragt sie genau den Richtigen – trotz Ihres jungen Alters! Sehr weise, einen Zwerg zu fragen! Der Arm war kaum der Rede wert, der Kratzer. Brandur wusste, dass es um den Arm schlimm stand, aber das konnte er niemals offen zugeben, schon gar nicht vor einem kleinen Mädchen. Desinteresse für ein Juwel war dagegen unmöglich. Verdutzt brummte Brandur: “Hallo Kind, äh, junge Frau, öhm Mädchen?“ Aera deutete auf den Arm. „Ach der Arm – kaum der Rede wert!“, beantwortete der Zwerg die unausgesprochene Frage. „Du .. ähm, Ihr ... hast ... ähm … habt, bei den Göttern, diese höflichen Anreden sind alle kompliziert!“ Brandur setzte erneut an: „Einen EDELSTEIN sagst du! Lass mich einen kurzen Blick drauf werfen, ob er was wert ist!”
Brandur saß nach wie vor auf dem Hosenboden und kontrollierte seine Ausrüstung. Alles war da, nichts beschädigt. Keine weiteren Verwundungen. Dafür schmerzte sein Arm wie ein glühendes Eisen in der Hand. Was für ein hinterhältiger Angriff! Niemand, dem man sich entgegenstellen konnte. Solch „Hokuspokus“ war keine anständige Art des Kampfes. Äußerst vorsichtig bewegte Brandur den gebrochenen Arm. Das war ein Fehler der übelsten Sorte. Er gab es ungern zu, aber der Arm war unbrauchbar. Damit würde er keine Goldmünze vom Boden aufheben, geschweige denn einen Humpen Bier heben. Ein Bier! Ein kühles, großes, würziges, schaumiges Bier! Der Zwerg verzog das Gesicht. Aera wollte beim Anblick des schmerzverzerrten Ausdrucks von Brandur direkt losstürmen, zügelte sich aber und dachte an die Worte ihres Vaters: "Zuviel Misstrauen ist immer ein Unglück. Denke also daran - begegnest Du zu großem Misstrauen ist allzu große Vertrautheit schädlich.“ Sie hatte seine Ratschläge häufig nicht verstanden. In diesem Moment erkannte sie, welche Lektion er ihr an jenem Tag beigebracht hatte. Des Zwergen Augen schauten unter den buschigen, schwarzen Augenbrauen misstrauisch in die Umgebung, da war direkte, übermäßige Hilfe nicht angebracht. Fieberhaft dachte Aera nach und als ob die Ratschläge aus Vaters Kräuterbeutel kämen, presste sie diesen vor die Brust. Was hatte sie von Zwergen gehört. „Ach Vater, wie gut dass ich zu Edda ins Gasthaus gehen durfte. Die Geschichten über die Zwerge, nie hätte ich gedacht, dass sie mir helfen könnten.“ Aera lief näher an die Gruppe und richtete ihr Wort direkt an den Brandur: „Herr Zwerg, ich benötige dringend Hilfe mit der Bestimmung eines leuchtenden grünen Edelsteins. Da ich aber kein Geld habe, biete ich einen Handel an: Wie ich sehen muss sind Sie verwundet. Da der Kräuterkundige … da er ... also ...“, Aera räusperte sich, „ich kann den Knochen im Arm richten und auch die Haut darüber versorgen. Helfen wir uns gegenseitig?“ Brandurs Augen wurden groß. Seine dicke Nase kräuselte. Die Überraschung war unverkennbar. Da stand ein junges Menschenmädchen, aus Sicht eines Zwerges kaum alt genug, um sich allein versorgen zu können. Sie kannte sie seinen Namen. Sie wusste von seinem Arm. Sie wollte, dass er sich einen Edelstein anschaute! Wenigstens fragt sie genau den Richtigen – trotz Ihres jungen Alters! Sehr weise, einen Zwerg zu fragen! Der Arm war kaum der Rede wert, der Kratzer. Brandur wusste, dass es um den Arm schlimm stand, aber das konnte er niemals offen zugeben, schon gar nicht vor einem kleinen Mädchen. Desinteresse für ein Juwel war dagegen unmöglich. Verdutzt brummte Brandur: “Hallo Kind, äh, junge Frau, öhm Mädchen?“ Aera deutete auf den Arm. „Ach der Arm – kaum der Rede wert!“, beantwortete der Zwerg die unausgesprochene Frage. „Du .. ähm, Ihr ... hast ... ähm … habt, bei den Göttern, diese höflichen Anreden sind alle kompliziert!“ Brandur setzte erneut an: „Einen EDELSTEIN sagst du! Lass mich einen kurzen Blick drauf werfen, ob er was wert ist!”
 24.Eintrag
24.Eintrag
 Buck war nach dem Donnern panisch in das Getreidefeld hinter Franzibians Hütte geflüchtet. In einer Mulde Schutz suchend, hatte er sich auf dem Boden zusammengerollt. Für ihn war das alles zu viel. Er lag auf dem Boden, weinte und schluchzte. So viele Tote, so viele Fremde, so viele Dinge, die er nicht verstand. Alles war kaputt. Buck traute sich nicht, zum Himmel zu Blicken. Er fürchtete, jederzeit von einem Blitz erschlagen zu werden. Es war ein Gewitter ohne Regen. Er verstand es nicht. Er weinte lange, bis keine Tränen mehr kamen und sein Hals kratzte, seine Nase verstopft und seine Augen geschwollen waren. Bis eine feuchte, kalte Nase ihn sanft an der Wange stupste. Bis eine warme trockene Zunge ihm die getrockneten Tränen vom Gesicht leckten. Bis ein wohliges Gefühl der Geborgenheit und des Schutzes in sanft aber bestimmt ausfüllte. Buck streckte seine Arme aus, grub seine Hände in das struppige Fell und seufzte.
Buck war nach dem Donnern panisch in das Getreidefeld hinter Franzibians Hütte geflüchtet. In einer Mulde Schutz suchend, hatte er sich auf dem Boden zusammengerollt. Für ihn war das alles zu viel. Er lag auf dem Boden, weinte und schluchzte. So viele Tote, so viele Fremde, so viele Dinge, die er nicht verstand. Alles war kaputt. Buck traute sich nicht, zum Himmel zu Blicken. Er fürchtete, jederzeit von einem Blitz erschlagen zu werden. Es war ein Gewitter ohne Regen. Er verstand es nicht. Er weinte lange, bis keine Tränen mehr kamen und sein Hals kratzte, seine Nase verstopft und seine Augen geschwollen waren. Bis eine feuchte, kalte Nase ihn sanft an der Wange stupste. Bis eine warme trockene Zunge ihm die getrockneten Tränen vom Gesicht leckten. Bis ein wohliges Gefühl der Geborgenheit und des Schutzes in sanft aber bestimmt ausfüllte. Buck streckte seine Arme aus, grub seine Hände in das struppige Fell und seufzte.
 Der Platz vor Eddas Hütte füllte sich mit Personen. Leomar und Seylina waren nach draußen getreten, beide in ihre eigenen Gedanken vertieft. Aera sprach mit Brandur und deutete nach Süden. Najiba untersucht den Boden nach Spuren. Dieser große Wolf, sie hatte das Bild seiner Fänge vor Augen, musste in der Nähe sein. Ein großer, kräftiger Mann, mit grauer, rußiger Leinenkleidung und einem schweren Kittel, sowie ein dünner Junge neben ihn, standen wenige Schritte Abseits und beobachteten. Nurbat war mit den anderen der Versammlung nachgekommen und standen ein wenig hilflos herum. Als der Dorfvorsteher Leomar und Seylina erblickte. Mit einem fragenden Blick kam er auf sie zu: „ Bitte sagt mir, dass Edda noch lebt?“ Seylina nickte. Ihre Aufmerksamkeit galt jedoch dem Brunnen, hinter dem Dorfvorsteher. Das Wasser schien die Quelle allen Übels zu sein. Dort sollte eine Antwort liegen. Seylina wandte sich an Nurbat, "Entschuldigt bitte, dass ich mich Euch noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Seylina Silbermond. Darf ich fragen, wem das prachtvolle Pferd dort draußen gehört? Ein schönes Tier und sehr gut ausgebildet, wie es mir scheint." Seylina reichte Nurbat die Hand, wie es bei Menschen üblich war, wenn man sich vorstellte.“ Nurbat ergriff die Hand, stellt sich vor und erklärte, der Rappen gehöre einer Lady Zenia Zorkana, die gestern im Dorf eingetroffen und Gast bei Edda sei. Er meinte, sie hätten sie getroffen haben müssen, so schnell war sie mit dem Magier vorhin verschwunden. Leomar bestätigte die Worte. Er blickte sich um. Die Dame war nicht auf dem Platz. Seylina folgte ihrer Spur weiter das Wasser betreffend weiter: „Trinkt ihr aus dem Brunnen?“ Nurbart schüttelte energisch den Kopf: „Das Wasser ist verdorben. Alle Brunnen sind mit dem roten Stein gekennzeichnet. Wir holen Wasser aus dem Farbach im Norden. Franzibian hat uns das kurz vor seinem Tod geraten. Seitdem ist niemand krank geworden. Dachten wir zumindest. Jetzt hat es Edda erwischt!“ Leomar runzelte die Stirn: „Ich zweifle die Theorie des Wassers nicht an, aber ich sehe Unklarheiten darin. Mir fällt einiges ein, von dem ich in meiner Zeit an der Akademie las, aber wenn diese Magie wirklich den dämonischen Sphären entspringt, an die ich jetzt denken muss, dann mögen die Götter unseren verlorenen Seelen gnädig sein.“ Nurbart wurde bleich. Seine Lippen zitterten. „Dämonisch, habt ihr gesagt?“ Leomar schollt sich selbst. Er verwirrte sich und andere. Keine professionelle Art. „Rein eine Theorie, die erst bewiesen werden müsste. Keine Panik. So kann man nicht denken!“ Leomars rhetorische Pause bewirkte wenig Verbesserung. „Wie sollte einen chronologischen Ablauf der Vorfälle im Dorf aufzeichnen. Wer wann wie krank wurde, wie der Verlauf war und … hat jemand eine Vergiftung je überlebt?“ Der Dorfvorsteher schwenkte langsam den Kopf von rechts nach links. „Niemand! Franzibian hat immer ein Büchlein geführt über seine Patienten. Aera könnte es haben. Ich erinnere mich nur, wie er meinte, Tiere würden schneller davon befallen werden und die ersten Symptome wären Aggressivität und Verwirrung.“ „Wie bei dem Stier auf dem Weg“, merkte Seylina an. „Ist alles Wasser im Umkreis verunreinigt oder nur eine bestimmte Quelle?“, erkundigte sich der Magier. „Puh, keine Ahnung“, entfuhr es Nurbart. „Die Brunnen werden vom Farbach gespeist. Es gibt unzählige kleine Bächlein und Abzweige. Im Nordosten liegt der Farteich und im Südosten der Unterteich. Ich habe eine grobe Karte der Umgebung in meinem Haus.“ Wenn ihr mir folgt, gebe ich sie Euch. Seylina winkte ab: „Ich schau mir den Brunnen an.“ Leomar schielte über seine Schulter zur Hütte. Er könnte an der Frau vielleicht verfolgen, wie die Krankheit exakt weiter verläuft und daran erkennen wie es zum Tode führt. Schnell wischte er den Gedanken beiseite. Das war dämonisches Gedankengut. Das war Unrecht. Mit einem kurzen, stillen Stoßgebet, bat er die Göttin der Magie um Verzeihung und deutete Nurbart an, vorauszugehen.
Der Platz vor Eddas Hütte füllte sich mit Personen. Leomar und Seylina waren nach draußen getreten, beide in ihre eigenen Gedanken vertieft. Aera sprach mit Brandur und deutete nach Süden. Najiba untersucht den Boden nach Spuren. Dieser große Wolf, sie hatte das Bild seiner Fänge vor Augen, musste in der Nähe sein. Ein großer, kräftiger Mann, mit grauer, rußiger Leinenkleidung und einem schweren Kittel, sowie ein dünner Junge neben ihn, standen wenige Schritte Abseits und beobachteten. Nurbat war mit den anderen der Versammlung nachgekommen und standen ein wenig hilflos herum. Als der Dorfvorsteher Leomar und Seylina erblickte. Mit einem fragenden Blick kam er auf sie zu: „ Bitte sagt mir, dass Edda noch lebt?“ Seylina nickte. Ihre Aufmerksamkeit galt jedoch dem Brunnen, hinter dem Dorfvorsteher. Das Wasser schien die Quelle allen Übels zu sein. Dort sollte eine Antwort liegen. Seylina wandte sich an Nurbat, "Entschuldigt bitte, dass ich mich Euch noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Seylina Silbermond. Darf ich fragen, wem das prachtvolle Pferd dort draußen gehört? Ein schönes Tier und sehr gut ausgebildet, wie es mir scheint." Seylina reichte Nurbat die Hand, wie es bei Menschen üblich war, wenn man sich vorstellte.“ Nurbat ergriff die Hand, stellt sich vor und erklärte, der Rappen gehöre einer Lady Zenia Zorkana, die gestern im Dorf eingetroffen und Gast bei Edda sei. Er meinte, sie hätten sie getroffen haben müssen, so schnell war sie mit dem Magier vorhin verschwunden. Leomar bestätigte die Worte. Er blickte sich um. Die Dame war nicht auf dem Platz. Seylina folgte ihrer Spur weiter das Wasser betreffend weiter: „Trinkt ihr aus dem Brunnen?“ Nurbart schüttelte energisch den Kopf: „Das Wasser ist verdorben. Alle Brunnen sind mit dem roten Stein gekennzeichnet. Wir holen Wasser aus dem Farbach im Norden. Franzibian hat uns das kurz vor seinem Tod geraten. Seitdem ist niemand krank geworden. Dachten wir zumindest. Jetzt hat es Edda erwischt!“ Leomar runzelte die Stirn: „Ich zweifle die Theorie des Wassers nicht an, aber ich sehe Unklarheiten darin. Mir fällt einiges ein, von dem ich in meiner Zeit an der Akademie las, aber wenn diese Magie wirklich den dämonischen Sphären entspringt, an die ich jetzt denken muss, dann mögen die Götter unseren verlorenen Seelen gnädig sein.“ Nurbart wurde bleich. Seine Lippen zitterten. „Dämonisch, habt ihr gesagt?“ Leomar schollt sich selbst. Er verwirrte sich und andere. Keine professionelle Art. „Rein eine Theorie, die erst bewiesen werden müsste. Keine Panik. So kann man nicht denken!“ Leomars rhetorische Pause bewirkte wenig Verbesserung. „Wie sollte einen chronologischen Ablauf der Vorfälle im Dorf aufzeichnen. Wer wann wie krank wurde, wie der Verlauf war und … hat jemand eine Vergiftung je überlebt?“ Der Dorfvorsteher schwenkte langsam den Kopf von rechts nach links. „Niemand! Franzibian hat immer ein Büchlein geführt über seine Patienten. Aera könnte es haben. Ich erinnere mich nur, wie er meinte, Tiere würden schneller davon befallen werden und die ersten Symptome wären Aggressivität und Verwirrung.“ „Wie bei dem Stier auf dem Weg“, merkte Seylina an. „Ist alles Wasser im Umkreis verunreinigt oder nur eine bestimmte Quelle?“, erkundigte sich der Magier. „Puh, keine Ahnung“, entfuhr es Nurbart. „Die Brunnen werden vom Farbach gespeist. Es gibt unzählige kleine Bächlein und Abzweige. Im Nordosten liegt der Farteich und im Südosten der Unterteich. Ich habe eine grobe Karte der Umgebung in meinem Haus.“ Wenn ihr mir folgt, gebe ich sie Euch. Seylina winkte ab: „Ich schau mir den Brunnen an.“ Leomar schielte über seine Schulter zur Hütte. Er könnte an der Frau vielleicht verfolgen, wie die Krankheit exakt weiter verläuft und daran erkennen wie es zum Tode führt. Schnell wischte er den Gedanken beiseite. Das war dämonisches Gedankengut. Das war Unrecht. Mit einem kurzen, stillen Stoßgebet, bat er die Göttin der Magie um Verzeihung und deutete Nurbart an, vorauszugehen.

 Seylina holte mit dem Eimer, nachdem sie den dort platzierten roten Stein herausgenommen hatte, eine Fuhre Wasser aus dem Dorfbrunnen. Sie schnuppert über der Oberfläche der Flüssigkeit. Es roch sauber, ein wenig alt vielleicht. Ihre scharfen Augen konnte keine Trübung oder Verfärbung ausmachen. Die gemurmelten Worte der Magie gaben der Elfe Gewissheit. Das Wasser hatte keinerlei magische Bestandteile. Ein dämonischer Fluch oder ähnliches würde ihrer Meinung nach, kein klares, sauberes Wasser bedeutet. Solche Ausgeburten der Niederhöllen würden Wasser in schwarzen Schlamm oder eine übel riechende Brühe verwandeln. Blieb Gift übrig. Ein Gift, das weder zu riechen, noch zu schmecken war. Das erklärte jedoch in keiner Weise die seltsamen Nebelschwaden, die sie mittels Magie bei Edda entdeckt hatten. Irgendwer oder irgendetwas spielte ein böses Spiel. Der weiße Wolf, der sie angegriffen hatte ohne, dass der Rappen reagiert hatte. Ein Blitz aus heiterem Himmel, trotz strahlend blauem Himmel. Ein Blitz der nicht tötete, sondern nur benommen machte. Zufälle? Unwahrscheinlich. Beobachtete sie jemand? Sie mussten das schnell herausfinden. Seylina blickte zu Eddas Hütte.
Seylina holte mit dem Eimer, nachdem sie den dort platzierten roten Stein herausgenommen hatte, eine Fuhre Wasser aus dem Dorfbrunnen. Sie schnuppert über der Oberfläche der Flüssigkeit. Es roch sauber, ein wenig alt vielleicht. Ihre scharfen Augen konnte keine Trübung oder Verfärbung ausmachen. Die gemurmelten Worte der Magie gaben der Elfe Gewissheit. Das Wasser hatte keinerlei magische Bestandteile. Ein dämonischer Fluch oder ähnliches würde ihrer Meinung nach, kein klares, sauberes Wasser bedeutet. Solche Ausgeburten der Niederhöllen würden Wasser in schwarzen Schlamm oder eine übel riechende Brühe verwandeln. Blieb Gift übrig. Ein Gift, das weder zu riechen, noch zu schmecken war. Das erklärte jedoch in keiner Weise die seltsamen Nebelschwaden, die sie mittels Magie bei Edda entdeckt hatten. Irgendwer oder irgendetwas spielte ein böses Spiel. Der weiße Wolf, der sie angegriffen hatte ohne, dass der Rappen reagiert hatte. Ein Blitz aus heiterem Himmel, trotz strahlend blauem Himmel. Ein Blitz der nicht tötete, sondern nur benommen machte. Zufälle? Unwahrscheinlich. Beobachtete sie jemand? Sie mussten das schnell herausfinden. Seylina blickte zu Eddas Hütte.
<< Zurück blättern Weiter blättern >>
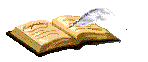
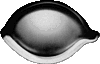 Inhalt
Inhalt
 Beilunker Reiter
Beilunker Reiter
 07.09.2014
07.09.2014

![]() Farhain
Farhain

![]()
![]() Inhalt
Inhalt
![]() Beilunker Reiter
Beilunker Reiter
![]() 07.09.2014
07.09.2014